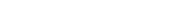erschienen in: taz Magazin, Nr. 6466 vom 09.06.2001, Seite VIII, 226.
Interview Steffen Gimberg
Nach wie vor Gutenberg
Wie will Mike Sandbothe (40) leben? Der Medienphilosoph fordert eine Vernetzung von Medientheorie und Praxis. Er beobachtet mit Spannung, wie sich weltweit subversive Formen von Öffentlichkeit weiterentwickeln, die erst mit Hilfe der interaktiven Medien entstehen konnten.
taz: Herr Sandbothe, Sie widmen sich den Medien in theoretischer wie praktischer Hinsicht - und wollen die Kluft zwischen den beiden Ufern überbrücken. Warum gibt es die eigentlich?
Sandbothe: Das hat damit zu tun, dass Medientheorie an vielen deutschen Universitäten nicht als intellektuelles Handwerkzeug für die Gestaltung von Wirklichkeit, sondern als akademischer Selbstzweck gelehrt wird. Die Vorstellung ist dabei die, Theorie könne zunächst in einem rein akademischen Raum entwickelt und dann erst nachträglich auf Praxis angewendet werden.
taz: Dann könnte die Theorie durchaus Impulse für die Praxis geben?
Sandbothe: Selbstverständlich. Doch wer heute an Medienwissenschaft interessiert ist und an die Hochschulen geht, wird nicht selten enttäuscht: Da jagt eine große Theorie die nächste und ein Methodendisput den anderen. Und das ist ja auch ganz spannend, aber wir müssen ganz klar überlegen, wie man akademische und mediale Praxis enger miteinander verflechten kann.
taz: Dann denken Sie doch mal laut!
Sandbothe: Politiker und Medienleute haben uns das mit der "Werkstatt Deutschland" ja gerade vorgemacht: Bäumchen-wechsel-dich von ganz und halb prominenten WürdenträgerInnen und entsprechenden ChefredakteurInnen zu gegenseitigen Werbezwecken. Wie so ein Austausch im Spaßmodus aussehen kann, war ja zu bewundern, als sich ein Minister Eichel in der Bild-Redaktion Gedanken über Blattstruktur, Redaktionsstrategie und das "Seite-eins-Luder" machte. Wir müssen jetzt Wege finden, wie man direkter Theorie und Praxis miteinander in Beziehung setzen kann und gleichzeitig den intellektuellen Anspruch der Theorie ernst nimmt.
taz: Was ist dabei Ihre Vision für die Hochschule als Hort der Theorie?
Sandbothe: Wir brauchen an den Unis so etwas wie Media Education Teams. Und die müssen zunächst gar nicht bei den Studierenden ansetzen, sondern bei den Lehrenden. Denn unsere akademische Kultur ist auch im Zeitalter des Internets nach wie vor eine Gutenberg-Kultur: Selbst da, wo wir das Internet nutzen, setzen wir es im Normallfall dafür ein, um Schrift zugänglich zu machen.
taz: Was raten Sie der Medienpraxis?
Sandbothe: Pragmatische Medientheorien könnten wirtschaftliche Entwicklungen im lokalen und im globalen Bereich wesentlich mitprägen und als Leitfaden für medienpolitische Zukunftsentscheidungen dienen. Den PraktikerInnen täte ein ordentlicher Theorie-Input sehr gut. Mit Blick auf den Journalismus liegt die zentrale Herausforderung zweifellos im Bereich der Schnittstellen: Die Verbindung der alten, klassischen Medien mit den neuen, interaktiven Medien erfordert ganz neue Kompetenzen, z. B. neue Recherchetechniken und Publikationsstrategien, die das Netz zur Verfügung stellt. Darauf müssen sich auch die PraktikerInnen einstellen, und die Medienwissenschaft kann da wesentliche Hinweise nicht nur auf aktuelle, sondern auch auf mögliche neue Nutzungsgewohnheiten geben.
taz: Welche denn?
Sandbothe: Zum Beispiel muss sich der Journalismus darüber klar werden, dass schon heute die bisher passiven MediennutzerInnen selbst bestimmte journalistische Tätigkeiten mit Hilfe des Internets vollziehen. Das, glaube ich, ist heute noch den wenigsten PraktikerInnen klar. Denn das heißt auch, dass sich viele Menschen jetzt gewissermaßen eigene journalistische Kompetenzen aufbauen, auf die der professionelle Journalismus reagieren muss.
taz: Die Konsequenz?
Sandbothe: Ganz einfach: Die Anforderungen an guten Journalismus werden höher!
taz: Und wie garantieren wir diesen neuen, besseren Journalismus?
Sandbothe: Wir brauchen zum Beispiel die Einbindung von Journalistenschulen in akademische Institutionen. An den Hochschulen selbst hält sich bisher eine akademische Journalistenausbildung in zu engen Grenzen. Wissenschaft und Praxis stehen jetzt vor den Herausforderungen durch die neuen Medien. Wenn man hier gemeinsam vorgeht, sind die Vernetzungsmöglichkeiten sehr groß.
taz: Sie mahnen also besonnene Reflexion in Theorie und Praxis an?
Sandbothe: Ja. Lassen Sie mich das Ausgangsproblem noch einmal deutlicher formulieren. Es gibt da eine interessante Parallele zwischen der Wissenschaft und ihrer Lust an der selbstzweckhaften Theorie - und der Unterhaltungskultur, die wir in den Massenmedien der Spaßgesellschaft erleben. Das ist quasi die gleiche Haltung: Theorie um der Theorie willen, Infotainment um des Infotainments willen, Medienaufmerksamkeit um der Medienaufmerksamkeit willen. Aber es fehlt, und da hat ja auch der taz-Kongress angesetzt, eigentlich eine Reflexion auf politische Zukunftsperspektiven, bei denen man Medien und Theorie nachhaltig nutzt, um Wirklichkeit langfristig und auf demokratisch anspruchsvolle Weise zu gestalten. Das nur an die nächsten Wahlen denkende Kungelspiel von Medien und Politik funktioniert in Deutschland ja bereits: Die Medien haben endlich ihren Kanzler und der Kanzler seine Medien gefunden. Der Fußballmoderator Schröder und seine MinisterInnenmannschaft versuchen ja ganz klar, die Medien zu funktionalisieren - und mit Hilfe von Spaß Politik zu machen. Die Frage wäre aber doch, ob es möglich ist, sowohl auf der akademischen Ebene als auch auf der Medienebene anspruchsvolle Formen politischer Arbeit mit Hilfe der Medien auf den Weg zu bringen.
taz: Sehen Sie dafür heute Ansätze?
Sandbothe: Ja, zum Beispiel bei der Frage, ob die Praxis des Internets nicht insgesamt zu tief greifenden Veränderungen einer wirklich politischen Öffentlichkeit führt: Hier können sich Menschen vernetzen, die ähnliche Ideen haben, allein aber nicht den Mut hätten, diese Ideen in die Praxis umzusetzen. Durch Mailinglisten und die weltweite Kommunikation mit anderen, die bisher so nicht möglich war, merken sie nun: Ich stehe ja gar nicht alleine da, sondern kann mich zusammen mit Gleichgesinnten aktiv einmischen und politische Prozesse beeinflussen. Die ganze Antiglobalisierungsbewegung wäre ohne dieses gemeinsame Bewusstsein und die "Globalisierung" durch die Neuen Medien gar nicht möglich gewesen.
taz: Welche Rolle käme denn dann den klassischen Massenmedien zu?
Sandbothe: Die klassische Struktur der Massenmedien - aktive Sender für passive Empfänger - wird durchaus erhalten bleiben. Spannend wird sein, wie sich sozusagen subversivere Formen von Öffentlichkeit weiterentwickeln, die erst mit Hilfe der interaktiven Medien entstehen. Genau das werden sich übrigens auch die Produzenten klassischer Medieninhalte fragen müssen. Denn neue mediale Formen wie zum Beispiel das nichtkommerzielle Berichterstattungsnetzwerk "Indymedia" widersprechen den bisherigen, eingeschliffenen Umgangsformen im Medienbereich: Hier operieren Menschen, die sich gar nicht als JournalistInnen verstehen, aus ihrem Handeln heraus, die eben nicht Information als Selbstzweck verbreiten.
taz: Sie fordern ganz konkret eine alternative Medienwerkstatt, eine Art praktisch arbeitendes Medienlabor. Was wären dessen Aufgaben?
Sandbothe: Leute unterschiedlicher Kulturen - Theorie, Praxis, Medienpolitik und Medienwirtschaft - müssen zueinander finden. Und auch da müssen natürlich Widerstände überwunden werden. Denn auch bei Praktikern herrscht eher wenig Interesse. Es muss aber darum gehen, kritische Perspektiven in die Medienpraxis einzuführen. Wichtig wird vor allem sein, dass jüngere Leute aus unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Medien, PraktikerInnen mit ernsthaftem Theorieinteresse und TheoretikerInnen mit gutem Praxisinstinkt zusammenkommen. Der taz-Kongress war bereits ein Schritt in diese Richtung. Ich könnte keinen vergleichbaren wissenschaftlichen Kongress nennen, auf dem intellektuell und politisch so viel in Bewegung gekommen ist. Durch die direkte Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medienpraxis in einem solchen Media-Lab könnten wir anspruchsvollere, nachhaltigere und langfristigere Konzeptionen von Medienpolitik in der Praxis umsetzen. Vielleicht wäre die taz als transmediales Interface der richtige Ort, um so etwas auf den Weg zu bringen.