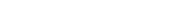Das folgende Gespräch diente als Basis für eine Radiosendung, die der WDR im Mai 1998 in der Reihe 'Am Abend vorgestellt' ausgestrahlt hat.
Ein Online-Gespräch zwischen Thomas Kleinspehn und Mike Sandbothe
Turkle Talk
Kleinspehn: Sie haben sich mit den Arbeiten von Sherry Turkle und insbesondere mit ihrem letzten Buch auseinandergesetzt, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist (Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet, Reinbek, Hamburg, 1998). Dazu gibt es im Netz auch ein Interview, das Sie mit Ihr vor etwa zwei Jahren geführt haben. Teilen Sie eigentlich ihre Thesen von den vielfältigen Identitäten, die sich durch das Netz ergeben?
Sandbothe: Sherry Turkles Thesen zur medialen Pluralisierung unserer Identitäten durch das Internet beziehen sich auf einen ganz bestimmten Bereich des Internet: die literarischen Textwelten der MUDs und MOOs. Zu der Zeit als Turkle gemeinsam mit Amy Bruckman MUDs und MOOs besucht und erforscht hat, waren die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Online-Chat Studierende amerikanischer Universitäten. Das sollte man bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse im Kopf behalten. Es wäre falsch, Turkles Thesen so zu verstehen, als wollte Turkle behaupten, daß „das Netz" per se zu einer Pluralisierung menschlicher Identität führt. Berücksichtigt man diese Einschränkung auf ganz bestimmte Internet-Nutzungsformen unter sehr spezifischen sozio-kulturellen Bedingungen, dann erscheinen mir Turkles Ergebnisse überaus plausibel.
Kleinspehn: Was fasziniert sie so an den Arbeiten von Sherry Turkle? Hat sich das inzwischen verändert?
Sandbothe: Meine persönliche Faszination für Turkles Buch möchte ich durch eine kleine Geschichte illustrieren, die mit meiner eigenen Entwicklung zu tun hat. Turkles Buch Life on the Screen ist Ende 1995 erschienen. Ich war zum Zeitpunkt des Erscheinens gerade in Boston und nahm an der Fourth World Wide Web Conference teil. Damals war das Internet in Deutschland noch kein wirkliches Thema, aber in den USA war die Kommerzialisierung des Netzes bereits im vollen Gang. Auf der Konferenz in Boston trafen sich die technischen Ahnen und Urahnen des World Wide Web – also Leute wie Tim Berners-Lee, Robert Cailliau und (aus der Großväter-Generation) Douglas Engelbart – mit WWW-Administratoren aus aller Welt, die in unterschiedlichen akademischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Praxisfeldern mit dem Web Erfahrungen gesammelt hatten. Es war ein faszinierendes Umfeld. Ich habe dort eine Menge gelernt. Aber zugleich war es für mich als Philosophen doch auch enttäuschend. Denn Geistes- oder Sozialwissenschaftler, die sich mit den tieferliegenden Auswirkungen der neuen Technologie beschäftigten, suchte ich auf der Konferenz vergeblich. Bereits ein Jahr zuvor hatte mir Terry Winograd – ein bekannter Computerwissenschaftler an der Stanford University – davon berichtet, das Sherry Turkle an einem Buch über das Internet arbeite. Das hatte mir damals Mut gemacht, an meiner etwas eigenwilligen Auffassung festzuhalten, daß das Internet auch und gerade philosophisch ein wichtiges Thema sei. An Winograds Worte erinnerte ich mich nun angesichts der erneuten Mutlosigkeit und Enttäuschung, die mich in Boston überfiel. Im Buchladen von MIT Press in Cambridge lag gleich ein ganzer Stapel des frisch gedruckten Werkes von Sherry Turkle aus. Ich erinnere mich noch sehr genau an meine erste Schnell-Lektüre des Buches. Ich saß in der Sushi-Bar des Kongreßzentrums am Copley Place in Boston, wo gerade die erwähnte WWW-Konferenz stattfand, und inhalierte Turkle. Mir war schnell klar, daß es sich bei diesem Buch um das Gründungsdokument der humanwissenschaftlichen Internetforschung handelte. Und tatsächlich: Heute ist Turkles Arbeit bereits ein Klassiker. Natürlich müssen wir heute viele ihrer Thesen kritisch prüfen und relativieren. Aber das hat mit der enormen Geschwindigkeit zu tun, in der sich Turkles Gegenstand – das Internet – unter den Bedingungen seiner Kommerzialisierung und Massenmedialisierung derzeit verändert.
Kleinspehn: Was ist das Spezifische am Netz? Müßte man nicht sagen, daß dieses Thema der Rollenvielfalt schon ein sehr altes ist: von Pygmalion und dem Golem bis hin zu Goffman's "Wir alle spielen Theater"? Oder gibt es da doch einen Unterschied?
Sandbothe: Das Alter eines Themas ist für einen Philosophen immer eher ein Qualitäts- und Wichtigkeitssiegel als ein Gegenargument. Natürlich geht die moderne Identitäts- Pluralisierung in der Theorie zurück bis auf Montaigne, Nietzsche, Goethe, Valéry und viele andere. So diagnostizierte Montaigne bereits 1580 in seinen Essais (II. Buch, 1. Kapitel): „Wir sind alle aus lauter Flicken und Fetzen und so kunterbunt unförmlich zusammengestückt, daß jeder Lappen jeden Augenblick sein eigenes Spiel treibt. Und es findet sich ebensoviel Verschiedenheit zwischen uns und uns selber wie zwischen uns und andern." Das Interessante an Turkles Untersuchungen ist, daß sie vor Augen führt, wie in den MUDs und MOOs die patchwork-artige Vielgestaltigkeit unseres Selbst, die von der Tradition eher als verborgene philosophische Wahrheit behandelt worden war, zu einer ganz einfachen Alltagserfahrung wird. Natürlich ist nach Goffman und Gergen auch für die Sozialwissenschaften klar, daß wir im wirklichen Leben ständig Theater spielen, d.h. verschiedene Rollen übernehmen und hin und wieder sogar unsere Identität wechseln. Aber für die MUD-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, die in verschiedenen Computer-Fenstern gleichzeitig mehrere Rollen spielen und sich immer wieder neue Identitäten konstruieren, wird die untergründige Pluralität, die bereits unser Off-line-Leben charakterisiert, zu einer offensichtlichen Tatsache und bewußten Lebenspraxis. Das ist der entscheidende Punkt. Etwas, das off-line im Verborgenen und Unbewußten geschieht, wird durch die Kommunikationspraxis in den MUDs und MOOs an die Oberfläche gebracht, wird bewußt vollzogen und ausgelebt.
Kleinspehn: Sehen Sie - wie Turkle - die postmodernen Theorien im Netz auf den Punkt gebracht / "bestätigt", wie sie sagt?
Sandbothe: Ja. Aber auch hier ist es wieder wichtig zu relativieren. Denn die Studierenden, deren Online-Kommunikationen von Turkle untersucht wurden, haben zu einem großen Teil die postmodernen Theorien im Laufe ihres Studium selbst rezipiert. In den USA haben postmoderne Denker wie Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida oder Lyotard in den letzten Jahren eine sehr weitreichende Rezeption nicht nur in den Literature Departments, sondern in fast allen humanwissenschaftlichen und darüber hinaus sogar in einigen natur- und technikwissenschaftlichen Disziplinen erfahren. Wir haben es hier also mit einer Art self- fullfilling-prophecy zu tun. Ich würde aus diesem Grund nicht gern von „Bestätigung" reden, sondern vielmehr von „Anwendung". Durch die pluralen Identitätsnetze, die in den MUDs und MOOs entstehen, wird nicht die Wahrheit der postmodernen Theorien bewiesen. Es zeigt sich nur, wie Leute leben, die Grundgedanken postmodernen Denkens konsequent in die virtuelle Alltagspraxis umsetzen.
Sandbothe: Jetzt spiele ich auch mal eine Rolle als advocatus diaboli: Affirmiert Sherry Turkle nicht die Strukturen des Netzes, die sie im Grund in ihrem Buch Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computerkultur (Reinbek, Rowohlt, 1984) noch sehr kritisch betrachtet hat? D.h. sie betrachtet zwar das dezentrierte Selbst im Gegensatz zu dem starren "autonomen" Ich des bürgerlichen Denkens, fragt aber nicht nach dem "Loch", das Strukturlosigkeit auch hervorrufen kann. Wird das im Netz aufgefangen?
Kleinspehn: Der Unterschied zwischen der Wunschmaschine und dem neuen Buch besteht darin, daß sich der Gegenstand von Turkles Forschungen – der Computer – in der Zeit, die zwischen den beiden Büchern liegt, stark verändert hat. Aus dem Stand-Alone-Computer, der mich narzißtisch mit mir selbst rückkoppelt ohne eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen, ist der kommunikative Netz-Computer geworden, der mich mit andernen Menschen weltweit in Beziehung setzt. Ich denke, wir sollten die pluralen Identitäten der Netzwelten nicht ohne weiteres mit strukturlosen und beliebigen Identitäten gleichsetzen. Natürlich besteht die Gefahr, daß Menschen im Internet so unterschiedliche Rollen spielen und so heterogene Identitäten konstruieren, daß sie die Pluralität nicht mehr zusammenhalten können. Auf diese Gefahr weist Turkle in dem Kapitel Identitätskrise explizit hin. Und sie macht zugleich klar, daß diese Gefahr nicht vom Internet irgendwie automatisch aufgefangen wird. Ihre These ist vielmehr die, daß es vom individuellen Nutzer und seiner real-life- Identität abhängt, wie er mit seinen virtuellen Identitäten im Internet umgeht. Begreift er das Internet auschließlich als Flucht- und Kompensationsraum, in dem er den Problemen zu entkommen versucht, die er mit seiner realen Identität hat, dann ist die Gefahr, daß er sich im Internet verliert, sehr groß. Versteht der Internet-Nutzer statt dessen jedoch die virtuellen Welten des Internet als kreative Experimentierfelder, in denen er Erfahrungen sammeln kann, die er dann auch für das wirkliche Leben nutzen kann, sieht die Sache ganz anders aus. Dann kann er durch das Netz unter Umständen lernen, seine verschiedenen Rollen und Identitäten miteinander zu verflechten und in ein produktives Wechselspiel zu versetzen. Es gibt also keine monokausale Determination des Nutzers durch die neue Technologie, sondern ein Spektrum von Nutzungsmöglichkeiten, die von unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern unterschiedlich gestaltet werden und zu unterschiedlichen Konsequenzen führen. Das ist ein wichtiger Punkt, den Turkle sehr gut herausarbeitet.
Kleinspehn: Ist es der Traum, daß künftig nur dezentrierte Individuen über das Netz kommunizieren, ansonsten aber auf sich selbst reduziert sind [wäre das überhaupt so?]?
Sandbothe: In meinen Augen wäre eine solche Zwei-Welten-Spaltung zwische Online und Offline-Kommunikation keine positive Utopie. Es geht vielmehr darum, aus der Netzkommunikation für die face-to-face-Kommunikation zu lernen und umgekehrt. Das setzt voraus, daß wir die virtuellen Aspekte im Realen und die realen Aspekte im Virtuellen durchschauen und anerkennen. Meine reale Identität ist ein Entwurf, der von meinen Zukunftsplänen getragen und von meiner Sicht auf meine Vergangenheit geprägt wird. Brechen meine Zukunftsprojekte zusammen, hat das Folgen für meine gegenwärtige Identität. Sie kommt in Bewegung, wird virtuell, d.h. beginnt mit anderen möglichen Identitäten, die sich aus neuen Zukunftsentwürfen ergeben, zu konkurrieren. Und umgekehrt gilt: habe ich mich im Netz seit mehreren Monaten oder sogar Jahren auf eine bestimmte Identität festgelegt und begonnen mich mit dieser Identität zu identifzieren, bekommt diese Identität ihre eigene Realitätsdimension. Wenn jemand der virtuellen Person, die ich in einem MOO seit längerem darstelle, Gewalt antut, dann fühle ich mich persönlich angegriffen. Und wenn ich meinerseits als diese Person einer anderen virtuellen Person Gewalt antue oder mich einfach schlecht verhalte, dann empfinde ich Scham und Reue. Mit der virtuellen Identität verbinden sich dann sehr reale Gefühle. Hat man die Übergängigkeit erst einmal durchschaut, die das Reale mit dem Virtuellen von innen her verbindet, dann stehen sich reale und virtuelle Identität nicht mehr wie Sein und Schein, wie Einheit und Vielheit, wie Wahrheit und Lüge gegenüber. Sie erscheinen dann vielmehr als zwei Weisen der Identitätskonstruktion, die sich auf sinnvolle Weise miteinander verflechten lassen und sich nur dadurch unterscheiden, daß sie in verschiedenen Medien stattfinden.
Kleinspehn: Wo ist die Grenze zwischen Netz und Alltag?
Sandbothe: Die Grenze zwischen Netz und Alltag fällt nicht mit der Grenze zwischen Schein und Sein oder Irrealität und Realität zusammen. Aber die Grenze, die Netz und Alltag voneinander trennt, hat mit dem Unterschied zwischen körperlicher Abwesenheit und körperlicher Anwesenheit zu tun. Im Netz sind unsere Körper nur als Bilder, als Beschreibungen, als Zeichen anwesend, nicht als taktile, berührbare und physisch verletzbare Entitäten. Im Netz bewegen wir uns in einem anderen medialen Kommunikationsraum. Es ist nicht der physikalische Raum der materiellen Körper und Atome, sondern der digitale Raum der immateriellen Daten und Bits.
Kleinspehn: Ist Kommunikation nicht doch mehr als nur eine digitale Verbindung über das Netz? Also MUDs können etwas erweitern, aber nicht ersetzen!?
Sandbothe: Ja. Das ist richtig. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Erfahrung der Netzkommunikation kann dazu führen, daß wir die face-to-face- Kommunikation erst wieder richtig schätzen lernen. Das Spiel der Gesten, der Reiz der kurzen Berührung, der unmittelbare Augenkontakt – das alles sind Dinge, die bei vielen Menschen längst routinisiert sind und deshalb in den ihnen eigenen Nuancen und feinen Bedeutungsdimensionen nicht mehr bewußt erfahren werden. Die anästhetische Reduktion der Kommunikation, die für die digitalen Textwelten der MUDs und MOOs charakteristisch ist, kann dazu führen, daß wir nach einem längeren Ausflug in die Welt der schriftbasierten Online-Interaktion die körperliche Präsenz des Anderen in der realen Kommunikation auf neue und intensivere Weise wahrnehmen. Es findet eine Revalidierung der face-to-face- Kommunikation statt. Wir lernen ihre Besonderheiten wieder schätzen und beginnen, sie sensibler einzusetzen. Auch unsere eigenen Gesten und Blicke werden uns bewußter, weil wir im Netz vorübergehend gezwungen waren, das, was wir sonst mit dem Körper unbewußt artikulieren, bewußt in Schriftsprache auszudrücken. Diese Bewußtheit bleibt erhalten, wenn wir von der Schriftwelt des Netzes in die Körperspiele der realen Welt zurückkehren. Aber auch hier läßt sich natürlich nichts generalisieren. Es kommt darauf an, wie der einzelne mit diesen Dingen umgeht. Das aber liegt nicht nur an seiner spezifischen psychischen Konstellation, wie Turkle nahelegt. Hier spielen auch gesellschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle, die bei Turkle meines Erachtens etwas zu kurz kommen. Sehr viel hängt davon ab, ob die Menschen im Rahmen gesellschaftlicher Institutionen lernen können, produktive Verflechtungen zwischen Virtualität und Realität herzustellen. Dabei spielen die Netznutzungsformen eine wichtige Rolle, die wir in der Schule oder an der Universität kennenlernen und die uns im Fernsehen oder in der Zeitung präsentiert werden. Die systematische Vermittlung von Medienkompetenz ist hier ein wichtiges Stichwort. Auf die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen und Universitäten kommen hier ganz neue und sehr wichtige Aufgaben zu, die sich nur im direkten face-to-face-Kontakt vernünftig lösen lassen. Aus diesem Grund bin ich sehr skeptisch, was die große Virtualisierungseuphorie in Sachen Bildung angeht. Natürlich müssen die neuen Technologien in den Unterricht einbezogen werden, aber der Unterricht selbst darf nicht total virtualisiert werden. Im Gegenteil. Der Unterricht an Schule und Universität ist vielmehr gerade ein Bereich, in dem die beschriebenen Revalidierungseffekte eine zentrale Rolle spielen sollten.
Kleinspehn: Ist die Flucht in die Vielfalt des Netzes, wie sie von Sherry Turkle konstatiert wird, nicht evtl. auch die Flucht vor gesellschaftlichen Codierungen?
Sandbothe: Jede Netzgemeinschaft entwickelt ihre eigenen gesellschaftlichen Kodierungen. Es gibt natürlich Menschen, die das Netz als Flucht- und Kompensationsraum nutzen. Um den gesellschaftlichen Kodierungen, die es auch im Netz selbst gibt, zu entkommen, flüchten sie sich in die Beliebigkeit und Belanglosigkeit von täglich wechselnden Identitäten. Sie springen von einer Netzgemeinde zur anderen, so wie sie von einer Homepage zur anderen surfen. Sie stellen keine Zusammenhänge und Verbindungen her, sondern leben immer nur in der momentanen Situation einer Identität, die keine Geschichte entwickelt und keine Angriffspunkte für gesellschaftliche Kodierungen bietet. Aber das sind, wie gesagt, Einzelfälle. Es gibt auch ganz andere Nutzungsmöglichkeiten. So wie ich meine Surferfahrungen im World Wide Web mit Hilfe von Suchmaschinen und Bookmarks systematisieren und dann die Spuren meiner Netzreisen auf der eigenen Homepage als Links programmieren und interessenspezifisch auswerten kann, so kann ich in MUDs und MOOs über lange Zeiträume hin eine Identität entwickeln, Freundschaften pflegen, Übertragungen vornehmen und bei Offline-Treffen mit MUD-Freunden Netzgemeinschaften in reale Gemeinschaften überführen. Der zentrale Bezugspunkt bleibt dann das wirkliche Leben.
Kleinspehn: Sind dann nach Ihrer Meinung die Folgerungen aus dem Buch, daß Körper, Sinne, Erfahrung, Lebendigkeit, vielleicht auch Geschichte obsolet geworden sind?
Sandbothe: Nein, das ganz und gar nicht! Wie gesagt: das Netz führt bei vernünftiger Nutzung bei den meisten Menschen viel eher zu einer Revalidierung, d.h. positiven Neubewertung und Wiederentdeckung von Körperlichkeit, Sinnlichkeit, lebendiger Erfahrung und kollektiver Geschichte.
Kleinspehn: „Ist das Internet männlich, weiblich oder beides?" haben Sie vor zwei Jahren in Ihrem Gespräch mit Sherry Turkle gefragt. Ist das nicht doch ein ‚Nebenwiderspruch'? Kann das Internet auch Ihrer Meinung nach zu einer befreiten Sexualität beitragen?
Sandbothe: Ich denke schon. Es muß nicht, aber es kann zu einer „befreiten Sexualität" führen. Auch hier hängt wieder alles davon ab, welchen Gebrauch die Menschen von der neuen Technologie machen. So kann die Möglichkeit, im Internet einmal probeweise in die Rolle des anderen Geschlechts zu schlüpfen, für die reale Geschlechterrolle eine Menge in Bewegung bringen. Wer im Internet Erfahrungen mit „Gender Swapping" gesammelt hat, kann unter Umständen ein besseres Einfühlungsvermögen in die sexuelle Wahrnehmung seines Partners bzw. seiner Partnerin entwickeln. Auch die Notwendigkeit, sexuelle Erfahrung und sinnliche Wahrnehmung in Worte zu fassen, mit der man beim TinySex konfrontiert wird, kann befreienden und kreativen Charakter haben. Der Raum des Sexuellen ist in der wirklichen Welt bei vielen Menschen immer noch ein Raum der Sprachlosigkeit und des Schweigens. Hier kann es viel bringen, wenn Internet-Kontakte dazu beitragen, das Sexuelle mit dem Sprachlichen zu verbinden. Daraus kann eine intelligentere und interessantere Sexualität hervorgehen. Wie gesagt: das kann sein, muß aber nicht. Auch hier sind wieder Gegenszenarien möglich: Leute, die nur noch virtuell genießen können, aber mit realen Körpern und physischer Nähe nichts mehr anfangen können...
Kleinspehn: Woher weiß ich, daß ich nicht mit einer Konserve kommuniziere, der lebendige Mensch dahinter längst verschwunden ist? Ist es überhaupt wichtig für Sie?
Sandbothe: Wenn es mir gelingt, Online-Kontakte in Offline-Treffen zu überführen, habe ich ein gutes Kriterium, das mir erlaubt zwischen Konserven (sprich: programmierten Bots) und wirklichen Menschen zu unterscheiden. Ich habe nichts gegen intelligente Bots. Es kann Spaß machen, gemeinsam mit einem Online-Freund, der kein Bot ist, bei einem Bot im Netz, der als Barkeeper programmiert ist, ein Bier zu bestellen. Warum nicht? Der Kontakt mit künstlichen Intelligenzen regt auch immer zum philosophischen Nachdenken an. Zugleich ist es aber doch auch so, daß man bereits nach kurzer Zeit merkt, womit man es zu tun hat, wenn man sich mit einem Bot einläßt. Die KI ist einfach noch nicht gut genug, um für die Kommunikation hier wirklich gefährlich zu werden.
Kleinspehn: Was machen wir damit, daß wir uns vielleicht ganz anders unterhalten hätten, wenn ich Sie mit dem Mikrophon besucht hätte, aber weil das Medium es erst einmal so will wir uns auf e-mail reduzieren / öffnen?
Sandbothe: Es ist ja nicht das Medium, das uns auf E-mail festlegt. Wir könnten ja auch telefonieren oder uns gemeinsam an einen Tisch setzen. Statt dessen haben wir die Entscheidung getroffen, E-mail zu nutzen. Das ist unser Ding, nicht eine Sache, die das Internet verschuldet. Im übrigen ist E-mail natürlich eine praktische Technik für Gespräche dieser Art. Die Schrift hat sich in der Moderne als ‚das' Medium der Wissenschaft etabliert. Daher liegt es nahe, ein solches Gespräch unter Einsatz der Schrift zu führen. Zugleich erlaubt es das Internet, die Schrift zu dialogisieren, d.h. interaktiv zu nutzen. Ein Online-Talk ist ein Medienmix, in dem die Vorteile der Schrift (Fixiertheit, Reproduzierbarkeit, Zeitunabhängigkeit) mit den Vorteilen des mündlichen Gespräches (Interaktion, Flexibilität, Unmittelbarkeit) verbunden werden.