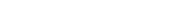erschienen in: Computernetze - ein Medium öffentlicher Kommunikation, hrsg. von Klaus Beck und Gerhard Vowe, Berlin: Spiess Verlag 1997, S. 125-137
Mike Sandbothe
Digitale Verflechtungen
Eine medienphilosophische Analyse von Bild, Sprache und Schrift im Internet
Einleitung
Medien prägen unser Bild von der Wirklichkeit. Das gilt für die Medien im weiten, im engen und im engsten Sinn. Unter Medien im weiten Sinn verstehe ich die Anschauungsformen von Raum und Zeit. Sie fungieren als grundlegende Medien unseres Wahrnehmens und Erkennens, indem sie Gegenstände als identische Entitäten synthetisierbar machen. Diese Einsicht liegt der "kopernikanischen Wende" zugrunde, mit der Kant der modernen Philosophie das Fundament bereitet hat. Die nachkantische Philosophie hat von Hegel und Nietzsche über Heidegger, Dewey, Cassirer und den späten Wittgenstein bis Derrida, Goodman, Gadamer und Rorty vor Augen geführt, daß die Stärke dieses Fundaments nicht - wie Kant meinte - in seiner transzendentalen Signatur, sondern vielmehr in seiner Beweglichkeit, Offenheit und Veränderlichkeit liegt. Bei unseren raum-zeitlichen "Weisen der Welterzeugung" (Goodman, 1984) handelt es sich nicht um starre, uniforme und ahistorische Apparaturen. Die Medien menschlicher Wirklichkeitskonstruktion sind vielmehr geprägt durch bildliche, sprachliche und schriftliche Zeichensysteme, die historisch kontingent sind und kulturell divergieren.
Bild, Sprache und Schrift sind gemeint, wenn ich von Medien im engen Sinn rede. Sie haben im zwanzigsten Jahrhundert im Zentrum vieler philosophischer Diskussionen gestanden. Zumeist ging es dabei darum, eines oder mehrere dieser Medien als verbindliche Grundstruktur menschlichen Wirklichkeitsverständnisses überhaupt oder zumindest als Fundament des für die westliche Kultur charakteristischen Weltbildes auszuweisen. Das Spektrum reicht vom "linguistic turn" der analytischen Philosophie (Rorty, 1967) über diverse Mißverständnisse, die Derridas frühes Konzept einer philosophischen "Grammatologie" (Derrida, 1983) im Umfeld postmodernen Denkens ausgelöst hat, bis zu zeitgenössischen Verkündigungen eines "pictorial turn" (Mitchell, 1994).
Gegenwärtig wird unübersehbar, daß weder die Medien im weiten noch die Medien im engen Sinn fixe, unveränderliche Strukturen darstellen, die einen festen Halt für die philosophische Theorie bieten. Unser Umgang mit ihnen hängt vielmehr auch von institutionellen und technologischen Entwicklungen ab, die sich im Bereich der Medien im engsten Sinn, das heißt der technischen Verbreitungsmedien vollziehen. Das gilt bereits für den Einfluß, den die Printmedien, das Radio und vor allem das Fernsehen auf unser Verständnis von Raum und Zeit sowie auf unseren Gebrauch von Bildern, Lauten und Buchstaben erlangt haben (Sandbothe/Zimmerli, 1994; Sandbothe, 1996a). Noch signifikanter werden die Verflechtungsverhältnisse, die zwischen den Medien im weiten, im engen und im engsten Sinn bestehen, durch die neue Bedeutung, die interaktiven Datennetzwerken wie dem Internet für unsere Wahrnehmung und unsere semiotische Praxis zukommt. Mit den interaktiven Datennetzwerken wird die digitale Revolution zur treibenden Kraft einer Transformation, welche die Praktiken unseres symbolischen Handelns reorganisiert. Diesem Transformationsprozeß gehe ich in den folgenden Überlegungen mit Blick auf die semiotischen Veränderungen nach, die unser Umgang mit den Medien im engen Sinn, d.h. mit Bild, Sprache und Schrift im Internet erfährt.1
Das Internet ist kein radikal neues Medium. Es handelt sich vielmehr um eine Hybridbildung aus bereits bekannten Medien. Die im Internet via Hochgeschwindigkeits- und Telekommunikationsleitungen vernetzten Computer verbinden und transformieren Anwendungen, Nutzungsformen und Inhalte, die wir aus Fernsehen, Telefon und face-to-face-Kommunikation, von Video, Radio und Printmedien her kennen. Gleichwohl besteht das Medienhybrid Internet nicht bloß - wie es das Marketing-Schlagwort Multimedia nahelegt - aus einer einfachen Summation oder einer diffusen Vermischung unterschiedlicher Medien. Das Internet ist vielmehr ein hochkomplexes und äußerst sensibel organisiertes Transmedium, in dem sich eine Vielzahl von kleinen Neuerungen zum Gesamteindruck eines 'neuen Mediums' verdichtet haben. Das Transmedium Internet läßt sich semiotisch als ein digitales Geflecht der bisher distinkt voneinander geschiedenen Zeichensorten Bild, Sprache und Schrift beschreiben, die unter Hypertextbedingungen präzise beschreibbare Verflechtungen eingehen und ihre Spezifika auf wissenschaftlich rekonstruierbare Weise verändern.
Das funktionale Zentrum des Internet bildet die graphische Anwenderoberfläche des World Wide Web (WWW). Sie wurde 1989 von Tim Berners-Lee und Robert Cailliau am europäischen Laboratorium für Teilchenphysik CERN entwickelt. Die ersten PC-Versionen von Browserprogrammen, mit denen man im World Wide Web navigiert, wurden 1993 vom National Center for Supercomputing Application (NCSA) an der University of Illinois at Urbana/Champaign unter dem Namen Mosaic vorgestellt. Der gegenwärtig am meisten verbreitete WWW-Browser Netscape wurde 1994 entwickelt. In die Browserprogramme sind die herkömmlichen, textorientierten Internetdienste (E-mail, Netnews, IRC, MUDs, MOOs) in graphisch überarbeiteter Form integriert. Während diese herkömmlichen Dienste am Modell linearer Textualität orientiert waren, vollzieht sich im World Wide Web der qualitative Übergang zur nicht-linearen Hypertextualität. Um die Veränderungen in unserem Zeichengebrauch deutlich werden zu lassen, welche dieser Übergang mit sich bringt, ist es hilfreich, zuvor die klassischen Distinktionen, die unseren Umgang mit Zeichen bisher bestimmt haben, in Erinnerung zu rufen.
Die klassische Trias: Bild, Sprache und Schrift
Traditionell werden in der Philosophie Sprache und Schrift als abstrakte und arbiträre Zeichensysteme dem Bild als konkretem und natürlichem Abbildungsmedium entgegengesetzt. Dabei kommt dem Bild ein eigentümlich ambivalenter Status zu. Einerseits erscheint es in der von Platon bis Hegel reichenden Tradition als "eine Nachbildnerei der Erscheinung" (Platon, 1971, S. 803 [598b]), d.h. als potenzierter Schein. Dem scheinhaften Bild werden dabei die vermeintlich scheinresistenteren Medien der Sprache und der Schrift gegenübergestellt. Andererseits fungiert das Bild im Hauptstrang der westlichen Tradition, in dem Erkennen als Abbilden und Wahrheit als adaequatio gedacht wird, als positives Leitmodell (vgl. hierzu kritisch: Heidegger, 1950). Sprache wird seit Aristoteles als Werkzeug der arbiträren Bezeichnung von wirklichkeitsabbildenden mentalen Bildern interpretiert, die "bei allen Menschen dieselben sind" (Aristoteles, 1974, S. 95 [16a]). Entsprechend wird die Schrift zu einem tertiären Supplement degradiert. Als phonetische dient sie dieser Tradition zufolge nur dazu, die lautlichen Zeichen der gesprochenen Sprache zu materialisieren und speicherbar zu machen. Das Ideal, dem dabei Sprache und Schrift gleichermaßen unterworfen werden, ist das am Modell des Bildes abgelesene Verfahren einer adäquaten und interpretationsneutralen Wiedergabe (dazu kritisch: Rorty, 1987). Wo die Sprache und die Schrift dieses Ideal nicht zu erfüllen vermögen, geraten sie in die dem Täuschungsverdacht ausgesetzte Position, in der sich im X. Buch der platonischen Politeia das Bild befindet.
In der von Derrida, Goodman, Gadamer, Rorty u.a. angestoßenen neueren Diskussion werden Bilder nicht länger in der Abgrenzung von Zeichen, sondern selbst als Zeichensysteme aufgefaßt, die nach dem Modell von Sprache und Schrift zu analysieren sind. Dabei werden jedoch häufig bestimmte traditionelle Voraussetzungen festgehalten. So wird zumeist angenommen, daß die Differenz zwischen sprachlichen, schriftlichen und piktorialen Zeichen eine Differenz sei, die auf verbindliche Weise in der semantischen und/oder syntaktischen Struktur der jeweiligen Zeichensysteme begründet ist (Scholz, 1991, insbes. Kapitel 4, S. 82-110). Diesen Annahmen steht die auf Wittgenstein zurückgehende These entgegen, daß ein Zeichen erst durch seinen Gebrauch als Laut, als Buchstabe oder als Bild bestimmt wird (Wittgenstein, 1982).Gerade unter den Bedingungen einer Gebrauchstheorie des Zeichens wird dann allerdings zum Teil weiterhin darauf insistiert, daß es eine einheitliche Art und Weise der Verwendung von etwas als Bild, als Sprache oder als Schrift gebe (Scholz, 1991, Kapitel 5, S. 111-139; Muckenhaupt, 1984, insbes. Kap. 4). Dieser Ansicht liegt die Vorstellung zugrunde, daß bestimmte Merkmale des Gebrauchs namhaft zu machen seien, die alle 'Bildspiele', 'Sprachspiele' bzw. 'Schriftspiele' als Bildspiele, Sprachspiele bzw. Schriftspiele auszeichnen. Diese durchgängigen Merkmale sollen es erlauben, die unterschiedlichen Zeichenspiele intern einheitlich zu definieren und die verschiedenen Zeichensorten gebrauchstheoretisch sauber voneinander zu scheiden. Dem ist entgegenzuhalten, daß es bei einer konsequenten Durchführung der pragmatischen Gebrauchstheorie des Zeichens naheliegt, davon auszugehen, daß wir es jeweils mit komplexen Bündeln von Bild-, Sprach- und Schriftspielen zu tun haben, die auch auf der gebrauchstheoretischen Ebene kein einheitliches Merkmal aufweisen, das allen Elementen der jeweiligen Menge gemeinsam ist. Bereits Wittgenstein hat zur Beschreibung komplexer Verflechtungsverhältnisse dieser Art die Metapher der "Familienähnlichkeiten" (Wittgenstein, 1984, S. 278 [67] u.ö.) eingeführt.2
Zur internen Verflechtung von Bild, Sprache und Schrift kommt die externe Verflechtung, die das Verhältnis der drei Zeichensorten zueinander bestimmt. So wenig ein durchgehendes Wesensmerkmal aufzeigbar ist, das Bilder als Bilder, Sprache als Sprache und Schrift als Schrift definiert, so wenig lassen sich feste Trennungslinien zwischen den unterschiedlichen Zeichentypen fixieren. Bilder, Laute und Buchstaben sind immer auch relativ auf und in Abhängigkeit von den instituionalisierten technischen Medien, die den Rahmen ihres Gebrauchs abstecken, voneinander abgegrenzt bzw. miteinander verflochten. Das moderne Mediensystem, in dem audiovisuelle Medien und Printmedien deutlich voneinander geschieden waren, legte bestimmte Grenzziehungen zwischen den Zeichensorten nahe. Das transmediale Zeichengeflecht des World Wide Web hebt diese Trennungen ein Stück weit auf und definiert die Relationen neu.
Die Verschriftlichung der Sprache
Bevor ich auf das für das transmediale World Wide Web charakteristische Geflecht von Bild, Sprache und Schrift eingehe, möchte ich auf die textorientierten Kommunikationsdienste zu sprechen kommen (vgl. hierzu auch Turkle, 1995 und Sandbothe, 1996b). Die textbasierten kommunikativen Landschaften des Internet sind älter als das World Wide Web.3 Bereits mit Blick auf die Nutzung dieser einfachen Dienste lassen sich interessante Veränderungen im praktischen Zeichenumgang herausarbeiten. Im IRC, in den MUDs und MOOs fungiert die Schrift als Medium der direkten synchronen Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Gesprächspartnern, die physisch getrennt sind und sich im Regelfall noch nie zuvor gesehen haben. Die dem Schriftmedium des Buches eigene Anonymität verbindet sich im "On-line Chat" ein Stück weit mit der synchronen Interaktivität und der aktuellen Präsenz der Gesprächspartner, die als charakteristisch für die gesprochene Sprache in der face-to-face-Kommunikation gilt. In der "Computer Mediated Communication" verflechten sich demnach Merkmale, die bisher als Differenzkriterien zur Unterscheidung von Sprache und Schrift dienten (vgl. hierzu Reid, 1992). Die Übergänge zwischen Sprache und Schrift werden fließend. Die traditionelle Auszeichnung der gesprochenen Sprache als Medium der Präsenz wird durch die 'appräsente Präsenz' der Teilnehmer im geschriebenen Gespräch des On-line Chat unterlaufen. Es ist dieses performative Schreiben eines Gesprächs, in dem Sprache interaktiv geschrieben statt gesprochen wird, das ich als Verschriftlichung der Sprache bezeichne.
Es ist mir wichtig, auf die Nähe der interaktiven textbasierten Kommunikationslandschaften zur alltäglichen face-to-face-Kommunikation ausdrücklich hinzuweisen. Denn diese wird in der aktuellen Diskussion nicht nur allzu häufig übersehen, sondern geradezu in Abrede gestellt. So hat Elena Esposito in ihrem Aufsatz Interaktion, Interaktivität und die Personalisierung der Massenmedien (Esposito, 1995) die Möglichkeit, daß "die telematische Kommunikation eine zugleich personalisierbare und nicht-anonyme Kommunikation" (Esposito, 1995, S. 247) eröffne, aus systemtheoretischer Perspektive abgewiesen. Zur Begründung ihrer für das interaktive Fernsehen und Teile des World Wide Web durchaus zutreffenden These stellt die Luhmann-Schülerin heraus, daß man es in den Chat-Foren auschließlich mit anonymer Kommunikation zu tun habe, und diese deshalb nicht personalisierbar sei, weil man nicht in der Lage wäre zu unterscheiden, ob man es mit Menschen oder nicht vielmehr mit sogenannten Robots, d.h. mit interaktiven Programmen, zu tun hat (Esposito, 1995, S. 252).
Tatsächlich vollzieht sich ein Großteil der Chat-Kommunikation zunächst nicht im Namen der wirklichen Identität, sondern unter dem Schutz eines Pseudonyms. Es erscheint mir jedoch wichtig, diese Formen einer - wie man sagen könnte - 'sekundären' Anonymisierung deutlich von der strukturellen Anonymität abzuheben, wie wir sie auf der Empfängerseite von den Printmedien oder dem Fernsehen her kennen. Der Chat-Teilnehmer bleibt nicht namenlos, sondern die Bedingung seiner Teilnahme ist vielmehr gerade, daß er sich selbst einen Namen gibt. Insofern ist die Chat-Kommunikation strukturell personale Kommunikation. Auch wenn der Teilnehmer sich ein Pseudonym als Namen wählt, ist er damit gleichwohl als 'persona', d.h. als Maske, als gespielte Identität präsent. Selbstverständlich besteht darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, die gespielte Identität durch die reale Identität zu ersetzen, d.h. die Kommunikation in einem authentischen Sinn zu personalisieren. Die von Esposito angeführte Gefahr, daß hinter der vermeintlich authentischen Person, mit der man zu kommunizieren glaubt, in Wirklichkeit eine Maschine stecken könnte, ist beim derzeitigen Stand der KI-Entwicklung zu vernachlässigen. Wer einmal mit einem Robot-Programm, dem gerade die Fähigkeit zur individuellen und kontextsensiblen Kommunikation fehlt, Kontakt hatte, weiß, wie einfach und schnell die Mensch-Maschine-Kommunikation als solche zu erkennen und von der Mensch-Mensch-Kommunikation zu unterscheiden ist. Das gilt auch für die derzeit in Entwicklung befindlichen 'Intelligent Agents', bei denen es im übrigen nicht in erster Linie um Mensch-Maschine-Kommunikation, sondern um eine auf unsere individuellen Interessen programmierbare Maschine-Maschine-Kommunikation geht.
Ein zweites Beispiel für die in der aktuellen Debatte feststellbare Tendenz zur medientheoretischen Überzeichnung der zwischen On-line-Kommunikation und face-to-face-Kommunikation bestehenden Unterschiede findet sich in Sybille Krämers Aufsatz Vom Mythos 'Künstliche Intelligenz' zum Mythos 'Künstliche Kommunikation' (Krämer, 1997). Die Berliner Philosophin formuliert darin folgendermaßen: "Das elektronische Netz, sofern es als Kommunikationsforum genutzt wir, hat den Charakter eines Rahmens, der festlegt, daß im Netz eine Art von Interaktion sich etabliert, welche im Horizont der terminologischen Unterscheidung von alltagsweltentlastendem 'Spiel' und alltagsweltverstärkendem 'Ernst' dem Spiel zugehörig ist" (Krämer, 1997, S. 98). Mit dieser sehr pauschalen und wenig phänomensensiblen Aussage verbindet Krämer die sprechakttheoretische These, daß "die Kommunikation in elektronischen Netzen (...) auf der Außerkraftsetzung der mit Personalität und Autorschaft verbundenen illokutionären und parakommunikativen Dimensionen unseres symbolischen Handelns" (Krämer, 1997, S. 97) beruhe. Daß diese These nicht als Wesensbestimmung der Internet-Kommunikation tauglich ist, da sie nur für bestimmte Nutzungformen zutrifft, die insbesondere in fiktionalen Kommunikationslandschaften wie MUDs und MOOs zu beobachten sind, wird von Krämer übersehen. Und selbst für MUDs und MOOs ist hervorzuheben, daß auch in fiktionalen Kontexten aus Spiel sehr schnell Ernst, aus der pseudonymen Kommunikation sehr schnell ein persönliches Gespräch werden kann. Aus fiktionalen Rollenspielen sind bereits häufig virtuelle Gemeinschaften und aus diesen ganz reale Freundschaften, ja sogar kirchlich abgesegnete Ehen entstanden.
Nicht zu Unrecht hat daher die Leipziger Philosophin Eva Jelden herausgestellt, daß für die gegenwärtige Entwicklung des Internet die zunehmende Realität des Virtuellen entscheidend sei. Diese aber ist Jelden zufolge gerade durch den Einschluß parakommunikativer Dimensionen charakterisiert. Dazu Jelden: "Mit jedem Mausklick bewege ich tatsächlich etwas in der Realität, teile mich mit, verschiebe Geld, treibe Handel u.a.m." (Jelden, 1996, S. 28). Jeldens Aussage ist freilich dahingehend einzuschränken, daß der Einschluß parakommunikativer Aspekte nicht, wie Jelden es nahelegt, für 'jeden' Kommunikationsakt im Netz charakteristisch ist, sondern eben für eine bestimmte, die realitätsbezogene Weise der Internetnutzung.4
Die zeichentheoretischen Konsequenzen, die sich mit Blick auf das World Wide Web insgesamt ergeben, sind komplexer als die beschriebenen Effekte im Bereich der interaktiven Kommunikationsdienste. Indem das World Wide Web die textorientierten Chats in sich integriert, nimmt es die durch diese Dienste ermöglichte schriftliche Variante des Dialogs auf. Neben die Verschriftlichung der Sprache, die sich in den Kommunikationsdiensten vollzieht, treten darüber hinaus zwei Transformationstendenzen, die speziell für das transmediale und hypertextuelle World Wide Web charakteristisch sind: die 'Verbildlichung der Schrift' und die 'Verschriftlichung des Bildes'. Ich beginne mit der ersten der beiden genannten Tendenzen. Sie kommt sowohl im bildhaften Umgang mit der phonetischen Schrift als auch in der Rehabilitierung nicht-phonetischer Schriften zum Ausdruck.
Zwei Aspekte der Verbildlichung der Schrift
Beide Aspekte der Verbildlichung der Schrift hat Jay David Bolter 1991 in seinem Buch Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing antizipiert. Den ersten Aspekt - den bildhaften Umgang mit der phonetischen Schrift - bringt Bolter in den Blick, wenn er herausstellt, daß bereits die Verwendung automatischer Gliederungsprogramme im Rahmen der Textverarbeitung den Effekt hat, "to make text itself graphic by representing its structure graphically to the writer and the reader" (Bolter, 1991, S. 26). Das vernetzte Hypertextsystem des World Wide Web radikalisiert diese im "electronic writing" grundsätzlich bereits angelegte Tendenz zur Verbildlichung der Schrift. Unter Hypertextbedingungen werden Schreiben und Lesen zu bildhaften Vollzügen. Der Schreibende gestaltet auf dem Bildschirm ein netzartiges Gefüge, ein rhizomatisches Bild seiner Gedanken. Dieses Bild ist vielgestaltig, assoziativ und komplex. Es besteht aus einer Pluralität unterschiedlicher Pfade und Verweisungen, die der Lesende zu individuell variierenden Schriftbildern formt, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen der offenen Struktur des Textes und den Interessen und Perspektiven des Lesenden ergeben.5 Hermeneutische Vollzüge und interpretatorische Prozesse, die sich bei der Lektüre gedruckter Texte allein im Bewußtsein des Lesers vollziehen, werden unter Hypertextbedingungen als Lektürespuren sichtbar, die den Text beim navigierenden Lesen auf der Software-Ebene mitkonstitutieren. Das hypertextuelle Gesamtgeflecht von Icons, digitalen Bildern, Audio- und Videosequenzen sowie linearen und nicht-linearen Texten läßt sich auf diesem Hintergrund metaphorisch als eine bildhafte Struktur, d.h. als 'textuelles Bild' oder 'Textbild' beschreiben.
Bolter selbst allerdings macht in seinem Aufsatz Das Internet in der Geschichte der Technologien des Schreibens (Bolter, 1997) von den oben akzentuierten Fortschreibungsmöglichkeiten, die sich aus seinem Buch von 1991 für die semiotische Analyse des World Wide Web ergeben, kaum Gebrauch. Zwar arbeitet er in aller Deutlichkeit heraus, daß und wie der Hypertext im World Wide Web "in einem Umsetzungsprozeß zwischen dem Leser und dem oder den (abwesenden) Autor(en), welche die entsprechenden Links in den Text eingebaut haben, erst hergestellt [wird]" (Bolter, 1997, S.43). Die sich in dieser Interaktion auf der semiotischen Ebene vollziehende Verbildlichung der Schrift bringt er jedoch nicht in den Blick. Statt dessen stellt er für das Verhältnis von Bild und Schrift heraus: "Nichtsdestoweniger bricht die Unterscheidung von Wort und Bild im elektronischen Schreiben nicht vollständig zusammen. Oder besser: die Unterscheidung kollabiert - nur, um sich immer wieder aufs neue zu bestätigen" (Bolter, 1997, S. 54).
Bolter hat sicherlich recht, wenn er betont, daß die Differenz von Wort und Bild auch im World Wide Web nicht vollständig zusammenbricht. Seine Schlußfolgerung jedoch, daß "die Unterscheidung kollabiert - nur, um sich immer wieder aufs neue zu bestätigen", erscheint mir problematisch. Bolter läßt dabei die Möglichkeit außer acht, daß sich im World Wide Web eine semiotisch relevante Veränderung unseres Umgangs mit Bildern, Lauten und Buchstaben vollzieht. Stellt man eine solche Möglichkeit in Rechnung, dann würde es sich bei den aktuellen Verschiebungen nicht um die einfache Iteration einer quasi-transzendentalen Opposition, sondern um eine medienspezifische Transformation des semiotischen Basisgefüges handeln. Die zeichentheoretische Differenz von Bild und Schrift bräche weder vollständig zusammen, noch bliebe sie starr und unverändert: sie konstituierte sich im Kontext eines medienspezifisch veränderten Gebrauchs vielmehr neu, d.h. sie formulierte den von ihr gemachten semantischen Unterschied auf veränderte Art und Weise und akzentuierte andere Aspekte als bisher.
Tatsächlich beginnt unsere Rede von 'Schrift' unter hypertextuellen Bedingungen Eigenschaften und Aspekte in sich aufzunehmen, die wir traditionell den Bildern zugeordnet haben. So ist das Lesen und Schreiben im World Wide Web von der visuellen Gestaltung, theatralen Inszenierung und ästhetischen Organisation bildhaft arrangierter Schriftzeichen nicht zu trennen. Ein gut komponierter Hypertext setzt sich aus aphoristischen Gedankenbildern zusammen, die auch losgelöst vom (variablen) Kontext eine in sich sinnvolle Szene darstellen und zugleich signifikante Übergänge in andere Szenen anbieten, zu denen interessante Bezüge bestehen. Die Situierung des Textes im Raum, die taktile Auszeichnung einzelner Zeichenkomplexe als anklickbare Links, die variabel gestaltbare Struktur des Texthintergrundes oder die von Java angebotenen Möglichkeiten, Buchstaben in Bewegung zu setzen und in graphische Szenen einzubetten - das alles sind Aspekte dessen, was ich zusammenfassend als Verbildlichung der phonetischen Schrift bezeichne.
Auch auf den zweiten Aspekt der Verbildlichung der Schrift - die Rehabilitierung nicht-phonetischer Schriften - hat Bolter in seinem Buch von 1991 als einen Grundzug des elektronischen Schreibraumes hingewiesen. Am Beispiel des Apple Macintosh Desktop macht er deutlich, daß Icons als "symbolic elements in a true picture writing" (Bolter, 1991, S. 51) fungieren. Und er fährt fort: "Electronic icons realize what magic signs in the past could only suggest, for electronic icons are functioning representations in computer writing" (Bolter, 1991, S. 52). Zusammenfassend schließlich stellt Bolter heraus: "Electronic writing is a continuum in which many systems of representation can happily coexist" (Bolter, 1991, S. 60). In seinem noch nicht im Druck erschienenen On-line-Artikel Degrees of Freedom (1996) hat Bolter seine 1991 formulierte Koexistenzthese, die sich aus der Analyse von Hypertextsystemen auf Stand-alone-Computern ergab, mit Blick auf das World Wide Web modifiziert. Bolter schreibt: "If the World Wide Web system began as an exercise in hypertextual thinking, it is now a combination of the hypertextual and the virtual. But the hypertextual and the virtual do not always combine easily. Usually the graphics and photographs tend to muscle the words out of the way" (Bolter, 1996, S. 5).
Die von Bolter neu eingeführte Distinktion zwischen dem 'Hypertextuellen' und dem 'Virtuellen' zeigt an, daß auch in dem Degrees-Aufsatz die Möglichkeit einer medienspezifischen Transformation im System der Zeichen nicht erwogen wird. Bolter zufolge ist das Hypertextuelle durch den Vorrang der Schrift, das Virtuelle durch die Dominanz von Bildern gekennzeichnet (Bolter, 1996, S. 2-5). Statt die komplexen Verflechtungsverhältnisse anzuerkennen, die sich im World Wide Web zwischen Schrift und Bild abzuzeichnen beginnen, hat Bolter seine alte Koexistenzthese durch eine neue Konkurrenztheorie ersetzt, derzufolge die unterschiedlichen Zeichensysteme, gerade indem sie miteinander um die Vorherrschaft im Schreibraum des vernetzten Computers kämpfen, in ihren internen Basisbestimmungen unverändert bleiben. Einerseits gesteht Bolter zwar zu, daß "the difference between the hypertextual and the virtual representation is not simply the difference between words and images" (Bolter, 1996, S. 5). Anderseits aber hält er daran fest, daß selbst in Fällen, in denen Bilder "serve as (...) icons in a multimedia presentation (...) the sign remains iconic" (Bolter, 1996, S. 5). Problematisch an dieser Äußerung ist der theoretische Rekurs auf die herkömmliche Bedeutung des Wortes 'ikonisch'. Bolter versucht, eine Veränderung im Gebrauch der Zeichen zu beschreiben, ohne bereit zu sein, die unter nicht-digitalen Medienbedingungen eingespielte Evidenz der alten Bedeutungen von Termini wie 'Bild' oder 'Schrift' zu relativieren. Daß eine solche Relativierung notwendig ist, um die sich vollziehenden Veränderungen angemessen in den Blick zu bekommen, wird besonders offensichtlich, wenn wir uns der dritten Transformation zuwenden, die im Internet zu einer Grunderfahrung unseres Zeichengebrauchs wird: der Verschriftlichung des Bildes.
Die Verschriftlichung des Bildes
Zwar fungieren Bilder auch im World Wide Web häufig noch nach traditionellem Muster als eine Art Quasi-Referenz. Sie unterbrechen den Fluß der Verweisungen und stellen künstliche Endpunkte von Menüs, d.h. Sackgassen im Hyperraum dar. Es gibt jedoch geschicktere, dem Hypertext-Medium angemessenere Formen der Bildpräsentation im Netz. Dabei werden verschiedene Bereiche des Bildes mit "source anchors" versehen, die auf jeweils unterschiedliche "destination anchors" verweisen. Das Bild funktioniert dann selbst wie ein Hypertext. Aktiviere ich einen Link innerhalb des Bildes, werde ich auf andere Bilder oder Texte verwiesen. Das Bild erscheint nicht länger als Referenz und Schlußpunkt eines Menüs, sondern wird selbst zu einem Zeichen, das auf andere Zeichen verweist. Ebenso wie die 'schriftlichen' Hyptertexte, die intern bereits nicht mehr linear, sondern rhizomatisch und bildhaft organisiert sind, funktioniert das hypertextuelle Bild als semiotische Schnittstelle im unendlichen Verweisungsgefüge des digitalen "Docuverse" (Nelson, 1981, S. 4/15).
Berücksichtigt man über diese externe Verschriftlichung des Bildes hinaus die interne Datenstruktur digitaler Bilder, dann wird deutlich, daß aus Pixeln zusammengesetzte Bilder bereits von ihrer technologischen Struktur her Schriftcharakter haben. Mit den entsprechenden Editor-Programmen lassen sich die Elemente, aus denen das digitale Bild besteht, wie die Buchstaben einer Schrift austauschen, verschieben und verändern. Bilder werden so zu flexibel redigierbaren Skripturen. Im digitalen Modus verliert das Bild seinen ausgezeichneten Status als Abbildung von Wirklichkeit. Es erweist sich als eine ästhetische Konstruktion, als ein technologisches Kunstwerk, dessen Semiotik sich intern aus der Relation der Pixel und extern durch die hypertextuelle Verweisung auf andere Dokumente ergibt (Mitchell, 1992).
Im Schlußteil seines Aufsatzes Das Internet in der Geschichte der Technologien des Schreibens (Bolter 1997) geht Bolter auf die signifikanten Entwicklungen ein, die sich im Bereich der Medientechnologie des Bildes vollziehen. Um die darin aufscheinenden semiotischen Transformationen thematisieren und gleichwohl die terminologische Fixierung auf die eingespielten Bedeutungsevidenzen von 'Bild' und 'Schrift' beibehalten zu können, verschiebt Bolter den reklamierten Evidenzanspruch der Bild-Schrift-Differenz von der Theorie-Ebene auf die Gegenstands-Ebene. So gesteht er im Schlußabsatz seines Artikels zwar zu, daß "einfallsreichere und intelligentere Formen hypertextueller Kommunikation existieren, in denen Wort und Bild auf selbstbezügliche Art miteinander interagieren" (Bolter, 1997, S. 55). Auf der Theorie-Ebene ist damit der Horizont einer semantischen Reorganisation der Bild-Schrift-Differenz eröffnet. Aber die terminologischen Konsequenzen, die daraus resultieren, werden von Bolter gleichwohl nicht gezogen. Diese Unterlassung wird im Rekurs auf Defizite begründet, die sich Bolter zufolge auf der Gegenstandsebene feststellen lassen: "Auch heute wird selbst der raffinierteste Betrachter des World Wide Web in Versuchung geführt, den komplexen Charakter einer Webseite zu vergessen, um sich auf das statische oder bewegte Bild als direkte Abbildung der Wirklichkeit zu konzentrieren" (Bolter, 1997, S. 54f).
Sicherlich ist es sinnvoll und wichtig, daß in zeichen- und medientheoretischen Analysen auch die Beharrungskraft mitberücksichtigt wird, die den eingespielten Bedeutungen von Termini wie 'Bild', 'Sprache' und 'Schrift' eigen ist. Aber um den sich kontinuierlich vollziehenden Übergang von den alten zu den neuen Verwendungsweisen angemessen zu verstehen, ist es darüber hinaus notwendig, die terminologischen Verschiebungen präzise nachzuzeichnen, durch die zukünftig vielleicht die 'eigentlichen' Bedeutungen der in Frage stehenden Termini bestimmt werden. Dies ließe sich erreichen, wenn wir die im Moment vielleicht tatsächlich nur latent erfahrbaren semiotischen Veränderungen sowohl auf der Theorie- als auch auf der Gegenstandsebene gezielt in den Blick nehmen und auf diesem Weg versuchen, den Bedeutungswandel gleichsam antizipatorisch zu beschreiben. Einer solchen zukunftsorientierten Analyse, die dem klassischen Theorieverständnis opponiert, das Wissenschaft auf die archäologische Rekonstruktion des Vergangenen festlegt, erschließen sich zugleich medienpragmatische und medienpolitische Anwendungsfelder. Die sich gegenwärtig vollziehende Ausgestaltung des Internet zu einem Massenmedium, das weit über den Bereich der akademischen Eliten hinaus das Kommunikationsverhalten und die Informationspraktiken moderner Gesellschaften zu prägen beginnt (vgl. hierzu Kubicek, 1996 und Morris/Ogan, 1996), markiert den noch weitgehend offenen Raum einer Mikropolitik des Zeichens - einen semio-politischen Raum, in dem darüber entschieden wird, welche Dimensionen des neuen Massenmediums Internet den Menschen zugänglich gemacht werden und welche nicht.
Literatur
Aristoteles (1974), Lehre vom Satz. In: ders., Kategorien. Lehre vom Satz (Organon I/II). Hamburg: Meiner.
Bolter, Jay David (1991): Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, N.J./London: Lawrence Erlbaum Associates.
Bolter, Jay David (1996): Degrees of Freedom. On-line-Publikation (http://www.lcc.gatech.edu/faculty/bolter/index.html)).
Bolter, Jay David (1997) Das Internet in der Geschichte der Technologien des Schreibens. In: Münker, Stefan / Rösler, Alexander (Hrsg.), Mythos Internet. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 37-55.
Bush, Vannevar (1945): As We May Think. In: Atlantic Monthly, Heft 176, Juli 1945.
Derrida, Jacques (1983): Grammatologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Esposito, Elena: Interaktion, Interaktivität und die Personalisierung der Massenmedien. In: Soziale Systeme, Nr. 2, 1995, S. 225-260.
Goodman, Nelson (1984): Weisen der Welterzeugung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Heidegger, Martin (1950): Die Zeit des Weltbildes. In: ders., Holzwege. Frankfurt a.M.: Klostermann, S. 73-110.
Jelden, Eva: Weltweiter Datenhighway. Virtuelle Gesellschaft, virtuelle Identität? In: FIFF-Kommunikation, 4/1996, Themenheft: Computer und Demokratie, S. 26-29.
Krämer, Sybille (1997): Vom Mythos 'Künstliche Intelligenz' zum Mythos 'Künstliche Kommunikation' oder: ist eine nicht-anthropomorphe Beschreibung von Internet-Interaktionen möglich? In: Mythos Internet, hrsg. von Stefan Münker und Alexander Rösler, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 83-107.
Kubicek, Herbert (1996): Das Internet auf dem Weg zum Massenmedium. In: Opennet 96. Dokumentation der 5. Internetkonferenz in Deutschland, Internet Society German Chapter, Berlin, S. 73-90.
Mitchell, William J. (1990) Was ist ein Bild? In: Bildlichkeit. Internationale Beiträge zur Poetik, hrsg. von Volker Bohn, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Mitchell, William J. (1992) The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era. Cambridge, Mass./London: MIT Press.
Mitchell, William J. (1994): Picture Theory. Chicago: The University of Chicago Press.
Mitchell, William J. (1995): City of Bits. Space, Place, and the Infobahn, Cambridge. Mass. und London: MIT Press.
Morris, Merril / Ogan, Christine (1996): The Internet as Mass Medium. In: Journal of Communication, Bd. 46, Nr. 1, Winter 1996, S. 39-50.
Muckenhaupt, Manfred (1986): Text und Bild. Tübingen: Narr.
Nelson, Theodor Holm (1981): Literary Machines. Swarthmore, Pa.: Self-published.
Nielsen, Jakob (1995): Multimedia and Hypertext. The Internet and Beyond, Boston u.a.: Academic Press.
Platon (1971): Politeia. In: ders., Werke in acht Bänden, hrsg. von Gunther Eigler, Bd. IV. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Reid, Elisabeth M (1992b): Electropolis: Communication and Community on Internet Relay Chat. In: Intertek, Jg. 3, Heft 3, Winter 1992, S. 7-15.
Rheingold, Howard (1994): Virtuelle Gemeinschaft. Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers, Bonn u.a.: Addison-Wesley.
Rorty, Richard (Hrsg.) (1967): The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method. Chicago/London: The University of Chicago Press.
Rorty, Richard (1987): Der Spiegel der Natur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Sandbothe, Mike / Zimmerli, Walther Ch. (Hrsg.) (1994): Zeit-Medien-Wahrnehmung, hrsg. von Mike Sandbothe und Walther Ch. Zimmerli, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Sandbothe, Mike (1996a): Mediale Zeiten. Zur Veränderung unserer Zeiterfahrung durch die elektronischen Medien. In: Synthetische Welten. Kunst, Künstlichkeit und Kommunikationsmedien, hrsg. von Eckhard Hammel, Essen: Blaue Eule, S. 133-156.
Sandbothe, Mike (1996b): Cool oder hot? Zur Ambivalenz virtueller Gemeinschaften im Internet. In: Forum Medienethik, Themenheft: Weltbild per Mausklick, Dezember, Stuttgart: Fachstelle für Medienarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart, S. 20-27.
Sandbothe, Mike (1997): Interaktivität-Hypertextualität-Transversalität. Eine medienphilosophische Analyse des Internet. In: Münker, Stefan / Rösler, Alexander (Hrsg.), Mythos Internet. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 56-82.
Scholz, Oliver R. (1991): Bild-Darstellung-Zeichen. Philosophische Theorien bildhafter Darstellung. Freiburg/München: Alber-Verlag.
Turkle, Sherry (1995): Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster
Wittgenstein, Ludwig (1984): Philosophische Untersuchungen. In: ders., Werkausgabe, Bd. 1. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Zu Auswirkungen auf die Medien im weiten Sinn vgl. Mitchell, 1995 und Sandbothe, 1997. [zurück]
- Zur Übertragung dieser Metapher, die bei Wittgenstein zur Charakterisierung der Ähnlichkeiten eingeführt wird, die zwischen unterschiedlichen Sprachspielen bestehen, auf bildtheoretische Fragestellungen vgl. Mitchell (Mitchell, 1990, insbes. S. 19-24). [zurück]
- Das erste MUD wurde 1979 von Richard Bartle und Roy Trubshaw an der University of Essex (Großbritannien), das IRC 1988 an der Universität von Oulu (Finnland) von Jarkko Oikarinen kreiert (vgl. hierzu Rheingold, 1994, S. 189 und 222). [zurück]
- Zur Unterscheidung verschiedener Weisen der Internetnutzung sowie zur Verflechtung dieser Nutzungsformen mit Rezeptionsgewohnheiten, die sich beim Umgang mit dem Fernsehen entwickelt haben, vgl. Sandbothe (Sandbothe, 1996b). [zurück]
- Vgl. hierzu die visionären und wegweisenden Überlegungen der Hypertextpioniere Vannevar Bush (Bush, 1945) und Theodor H. Nelson (Nelson, 1981). Zur Geschichte der Hypertextsysteme siehe Nielsen (Nielsen, 1995, Kapitel 3, S. 33-66). [zurück]