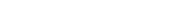erschienen in: Siegfried J. Schmidt, Geschichten & Diskurse. Abschied vom Kontruktivismus, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Dezember 2003, S. 7-22.
In der Printversion des folgenden Vorworts sind die aus dem Buch selbst (also aus Geschichten & Diskurse = Schmidt, 2003) zitierten Stellen versehentlich nicht nach der Paginierung der Druckfassung von Geschichten & Diskurse ausgewiesen worden, sondern nach der Paginierung des Manuskripts. Dieser Verlagsfehler ist in der Onlinefassung (s.u.) korrigiert worden, so dass im folgenden Text die Verweise auf Stellen in Geschichten & Diskurse (= Schmidt, 2003) korrekt ausgewiesen sind. Da der Verlag dem Autor des Vorworts nur das Manuskript, aber nicht die Druckfahnen des Buchs zugänglich gemacht hat, bestand keine Möglichkeit, die von Siegfried J. Schmidt an seinem Buch letzter Hand vorgenommenen inhaltlichen Veränderungen für das Vorwort noch zu berücksichtigen. Das hat Auswirkungen auf zwei Zitatstellen. Im vorliegenden Onlinetext wird darauf in Klammern hingewiesen.
Mike Sandbothe
Vorwort
Der Name Siegfried J. Schmidt ist in Deutschland eng mit dem disziplinenübergreifenden Forschungsprogramm des Radikalen Konstruktivismus (Schmidt 1987, 1992 u.a.) verbunden. Vom Epitheton des Radikalen hat sich der Autor bereits in früheren Publikationen distanziert. So treten in seinem viel gelesenen Buch Kognitive Autonomie und soziale Orientierung (1994) moderate Formen der kulturalistischen Diskursbegründung an die Stelle der ehemals als radikal bezeichneten naturalistischen Fundierungsversuche. Was aber geschieht in Geschichten und Diskurse (G&D)? Vollzieht der renommierte Mitbegründer, engagierte Verfechter und erfolgreiche Verbreiter konstruktivistischen Denkens in seinem neuen Buch tatsächlich (wie es im Untertitel heißt) den „Abschied vom Konstruktivismus“ und damit von seinem eigenen Forschungsprogramm? Oder verweist die Rhetorik des Untertitels doch eher auf eine interne Transformationsbewegung, bei der zentrale Grundfragen des konstruktivistischen Diskurses bewahrt und auf neue Weise in den Blick genommen werden?
Als etabliertes Paradigma erkenntnistheoretischer Forschung untersucht der Konstruktivismus die Binnenverfassung menschlicher Erkenntnisleistungen. Das ist traditionell ein genuin philosophisches Unternehmen. Die Philosophie befasst sich im Unterschied zu anderen Wissenschaften mit dem Denken des Denkens. Ihr Gegenstand hat aus diesem Grund eine andere Struktur als die Gegenstände der ‚normalen‘ Wissenschaften. Dem modernen Philosophen geht es nicht in erster Linie um die Erforschung eines bestimmten Gegenstandsbereichs (der Wirtschaft, des Rechts, des Lebens, der Natur, der Kultur etc.), sondern um die Art und Weise, wie wir Gegenstände als Gegenstände, Erkenntnisbereiche als Erkenntnisbereiche voneinander unterscheiden und damit überhaupt erst als solche konstituieren. In dieser Denktradition steht auch das erkenntnistheoretische Forschungsprogramm des Konstruktivismus.
Der schärfste Konkurrent konstruktivistischer Erkenntnistheorien ist der so genannte Realismus. Aus diesem Grund wird der Konstruktivismus häufig auch als Antirealismus bezeichnet. Der Realist geht davon aus, dass die zentrale Leistung menschlicher Erkenntnis darin besteht, eine unabhängig von ihr existierende Realität möglichst angemessen wiederzugeben. Demgegenüber hebt der Antirealist bzw. Konstruktivist hervor, dass wir zu einer solchen erkenntnisvorgängigen Realität keinen neutralen Zugang haben – denn wir müssten sie ja irgendwie erkennen, um von ihr reden zu können! – und dass es daher plausibler sei, die Realität nicht als Voraussetzung, sondern als Produkt menschlicher Erkenntnis aufzufassen.
Der Konstruktivismus in seiner radikalen Gestalt glaubte, die Richtigkeit der von ihm vertretenen antirealistischen Erkenntnistheorie im Rekurs auf naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse aus Biologie, Neurophysiologie und Kognitionspsychologie belegen zu können (Schmidt 1982a/b). Das Gehirn erscheint aus dieser Perspektive als ein autonomer Wirklichkeitskonstrukteur, der sich in seinen Operationen immer wieder auf seine eigenen Operationen bezieht, weil er alle äußeren Reize nur als Irritationen wahrnehmen kann bzw. in der ihm eigenen Nervensprache prozessieren muss. Die Unhaltbarkeit naturalistischer Argumentationsstrategien besteht darin, dass beim Rekurs auf die vermeintlich objektive Beweiskraft neurobiologischer Forschungsergebnisse übersehen wird, dass diese bei konsequenter Umsetzung der konstruktivistischen Theorie ihrerseits als Konstruktionen aufzufassen sind und insofern keine den Realisten überzeugende Beweiskraft haben (Janich 1992).
In Reaktion auf Argumente dieser Art hat Schmidt in Kognitive Autonomie und soziale Orientierung (1994) versucht, die von ihm früher selbst vertretenen naturalistischen durch kulturalistische Begründungsformen zu ersetzen. Als argumentativer Ausgangspunkt diente ihm dabei der Gedanke, dass menschliche Beobachter ihre Operationen nicht (wie die konstruktivistische Unterscheidungslogik von Spencer Brown bis Niklas Luhmann unterstellt) in einem „unmarked space“ vollziehen. Statt dessen ging Schmidt im Anschluss an den Social Constructionism von Kenneth J. Gergen davon aus, dass menschliche Beobachter „‚immer schon’ in einem kulturell und sozialstrukturell sehr nachhaltig ‚markierten space’ operieren“ (Schmidt 1994, 47). Das zentrale Anliegen des Buchs von 1994 bestand darin, die hermeneutische Unhintergehbarkeitsthese konstruktivistisch zu wenden und im Rekurs auf empirische Forschungsergebnisse aus den Kultur- und Sozialwissenschaften zu plausibilisieren.
Anders als in Kognitive Autonomie und soziale Orientierung wechselt Schmidt in G&D nicht nur den fachwissenschaftlichen Referenzbereich seiner Begründungsstrategie, sondern diese selbst. An die Stelle einer empirischen Plausibilisierung konstruktivistischen Denkens, die kombinatorisch verfährt und sich an ausgewählten Forschungsresultaten fachwissenschaftlicher Einzeldisziplinen orientiert, tritt eine dezidiert philosophisch argumentierende Form diskursiver Selbstbegründung. Deren Ziel besteht darin zu explizieren, was wir in allem Denken, Reden und Handeln immer schon voraussetzen: nämlich Sinn.
Kultur- und Medienwissenschaftler untersuchen normalerweise nicht den Sinn von „Sinn“. Statt dessen setzen sie ihn voraus und interessieren sich für die Art und Weise, wie Sinn in Medien kulturell kommuniziert wird. Genau das tut auch Schmidt; und zwar in den beiden dezidiert medien- und kommunikationswissenschaftlichen Büchern, die er nach seinem Wechsel aus der Siegener Literaturwissenschaft in die Münsteraner Kommunikationswissenschaft vorgelegt hat (Schmidt 2000; Schmidt/Zurstiege 2000). In G&D aber schreibt Schmidt nicht als Medien- und Kommunikationswissenschaftler, sondern als Kultur- und Sprachphilosoph. Das hat gute Gründe. Sie haben mit dem Verständnis von Medien- und Kommunikationswissenschaft zu tun, das Schmidt vertritt.
Dieses Verständnis hat Schmidt in Kalte Faszination (2000) kulturwissenschaftstheoretisch grundgelegt und im Anschluss daran zusammen mit Guido Zurstiege in Orientierung Kommunikationswissenschaft (2000) fachspezifisch ausbuchstabiert. Von besonderer Bedeutung ist dabei das „integrative Medienkonzept“ (2000, 93), das er unter der Überschrift „Kompaktbegriff ‚Medium‘“ (2000, 94) entwickelt hat. Mit Blick auf dieses Konzept schreibt der Autor in G&D: „Wie an verschiedenen Stellen begründet, konzipiere ich Sprache nicht als Medium, sondern als Kommunikationsinstrument. Medien – beginnend mit der Schrift – konzipiere ich als Kompaktbegriff, der vier Komponentenbereiche systemisch integriert: Kommunikationsinstrumente wie Sprache und Bilder, technische Dispositive (von der Feder und dem Papier bis zur Internettechnologie), die sozial-systemische Ordnung dieser Dispositive (etwa Skriptorien, Verlage oder Funkhäuser), die Medienangebote, die aus dem Zusammenwirken dieser Komponenten resultieren“ (2003, 66).
Der zitierten Definition ist indirekt zu entnehmen, dass sich Kommunikationsinstrumente von Medien durch den Sachverhalt unterscheiden, dass sie ohne technische Dispositive, ohne soziale Institutionen und ohne die mit deren Hilfe produzierten und/oder distribuierten Medienangebote auskommen. Das leuchtet auf den ersten Blick ein. Wenn wir face to face miteinander sprechen, benötigen wir im Normalfall keine technischen Sprechapparate und müssen uns auch nicht auf Medieninstitutionen verlassen, die dafür sorgen, dass unsere Nachrichten den Empfänger erreichen. Das unterscheidet die natürliche Präsenzkommunikation ja gerade von der medial vermittelten Fernkommunikation. Zugleich aber gilt Schmidt zufolge, dass technisch und sozial implementierte Mediensysteme nicht ohne die Sinnprodukte auskommen können, die wir mit Hilfe von Kommunikationsinstrumenten wie Sprache und Bild produzieren. Auch wenn diese selbst keine Medien sind, handelt es sich bei ihnen doch gleichwohl um unverzichtbare Bestandteile von Medien; und zwar, weil sie die Sinnressourcen zur Verfügung stellen, die in Medien gespeichert, verarbeitet und distribuiert werden.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Schmidt mit G&D einen Perspektivenwechsel von der Medien- und Kommunikationswissenschaft zur Kultur- und Sprachphilosophie vollzieht. Die Beantwortung der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Sinn erfordert eine gezielte Thematisierung derjenigen Kommunikationsinstrumente, die von der Medien- und Kommunikationswissenschaft zwar als Bestandteile des Medienbegriffs vorausgesetzt, aber nicht eigens und als solche untersucht werden. Insofern kann man in der von Schmidt bevorzugten Terminologie sagen, dass die Kultur- und Sprachphilosophie einen „blinden Fleck“ zu ihrem Gegenstand hat, der für die Medien- und Kommunikationswissenschaft konstitutiv ist und sich ihr deshalb entzieht.
Schon durch den Titel seines Buchs macht Schmidt deutlich, dass der Sinnerzeugungsmechanismus menschlicher Kommunikationsinstrumente von ihm aus der Perspektive einer „Geschichten&Diskurse-Philosophie“ (2003, 100) untersucht wird. Dieses neuartige Theorieangebot wird vom Autor im vorliegenden Buch erstmals entwickelt. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man sich auf eine ganze Reihe von Basisannahmen einlassen. Geschichten und Diskurse sind das Resultat eines begrifflichen Unterscheidungsmechanismus, der allen natürlichen Sprachen als Bedingung der Möglichkeit von Sinn zugrunde liegen soll. Schmidt beschreibt diesen „Grundmechanismus“ (2003, 27) als „autokonstitutiven Zusammenhang von Setzung (...) und Voraussetzung (...)“ (2003, 29). Was ist damit gemeint?
Wenn wir eine Handlung vollziehen, einen Gedanken denken oder ein Gefühl empfinden, wählen wir (zumeist unbewusst) aus einem Spektrum von möglichen Handlungen, Gedanken und Gefühlen aus und entscheiden uns (häufig abermals unbewusst) für die Handlung oder den Gedanken oder das Gefühl, für die, für den oder für das wir uns entscheiden. Indem wir uns entscheiden, rücken wir etwas statt etwas anderem (X statt Y) ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Wir machen eine Setzung, die ihrerseits nur möglich ist unter der Bedingung, dass zuvor bereits andere Setzungen statt gefunden haben. Diese vorausgegangenen Setzungen nennt Schmidt Voraussetzungen. Sie treten nur zutage, wenn ich eine konkrete Setzung mache, das heißt, sie sind ihrerseits als Voraussetzungen einer bestimmten Setzung von dieser Setzung abhängig. Aus diesem Grund spricht Schmidt von einem autokonstitutiven Zusammenhang von Setzung und Voraussetzung. Die Voraussetzung ist Bedingung der Setzung und die Setzung ist Bedingung der Voraussetzung. Das eine ermöglicht das andere bzw. der Zusammenhang von Setzung und Voraussetzung erzeugt sich selbst, ist also autokonstitutiv.
Die Funktion derjenigen Sinnstrukturen, die Schmidt als „Geschichten&Diskurse“ bezeichnet, besteht nun darin, bei der Selektion einer zu verwirklichenden Setzung aus einem Set von möglichen Setzungen behilflich zu sein. Geschichten und Diskurse funktionieren wie ein „Selektionsfahrplan für anstehende Selektionen“ (2003, 69). Sie entlasten den einzelnen Menschen „von der neurotischen Dauerreflexion darüber, warum er A tut und nicht B bis Z und warum er über Alpha redet und nicht über Beta bis Omega“ (2003, 70). Das bedeutet konkret: Die Geschichten, die ich in meinem Leben bereits erlebt und gehört habe und die ich mir und anderen in Erzählungen vergegenwärtigen kann, helfen mir in konkreten Handlungssituationen dabei, eine bestimmte Handlung im Unterschied zu anderen möglichen Handlungen auszuwählen. Ähnliches gilt für die Diskurse, an denen ich teilnehme. Sie zeichnen bestimmte Sprechakte gegenüber anderen, bestimmte Gefühlsäußerungen gegenüber anderen aus und helfen mir, mich in einer konkreten Kommunikationssituation für einen bestimmten Sprechakt, eine bestimmte Gefühlsäußerung zu entscheiden.
Als komplexer Wirkungszusammenhang sind Geschichten und Diskurse eng miteinander verzahnt. Denn Diskurse sind als Vollzüge selbst Handlungen und insofern in Geschichten eingebettet, und Geschichten sind als sinnhafte selbst Kommunikationen und insofern in Diskurse eingebettet. Die Unterscheidung von (als Handlungszusammenhänge bestimmten) Geschichten und (als Kommunikationszusammenhänge bestimmten) Diskursen wird vom Autor daher als eine kontingente, aber funktionale Beobachterkategorie eingeführt. Dem korrespondiert, dass Schmidt Geschichten&Diskurse trotz der zentralen Bedeutung, die ihnen in seinem Theoriegebäude zukommt, keinesfalls als „Anfangsgründe postuliert, auf denen systematisch eine Theorie aufgebaut wird“ (2003, 58). Statt dessen handelt es sich bei den Geschichten, in die ich verstrickt bin, und bei den Diskursen, an denen ich teilnehme, selbst wieder um Setzungen, die Voraussetzungen haben. Diese Voraussetzungen beschreibt Schmidt als das Geschichten und Diskursen vorgelagerte Zusammenspiel von Wirklichkeitsmodellen und Kulturprogrammen.
Wirklichkeitsmodelle bestehen aus dem Gesamtspektrum von Kategorien und semantischen Differenzierungen, das einer Gesellschaft als „System von Sinnorientierungsoptionen“ (Schmidt 2003, 34) zur Verfügung steht. Zu den Kategorien zählen „zum Beispiel Alter, Geschlecht, Macht, Besitz, Verwandtschaft, Nahrung und Kleidung“ (2003, 31). Die semantischen Differenzierungen (alt/jung, männlich/weiblich etc.) operationalisieren die Kategorien, machen sie für konkrete Kommunikationsprozesse also einsetzbar. Die Aufgabe von Kulturprogrammen besteht nun darin, ein effektives „Unterscheidungsmanagement“ (2003, 40) im Umgang mit dem vorliegenden Wirklichkeitsmodell zu etablieren. Zu diesem Zweck werden bestimmte Kategorien und semantische Differenzierungen nach lebenspraktischen Gesichtspunkten miteinander vernetzt und gegenüber anderen kulturell ausgezeichnet und sozial habitualisiert.
Der komplexe Apparat von Begriffen, den Schmidt in seinem Buch entwickelt und im Anhang systematisch als Glossar zusammenstellt, dient dem Autor dazu, „den zentralen Ansprüchen konstruktivistischen Denkens“ (2003, 24) gerecht zu werden. Diese bestehen darin, „die vollständige Begründung der Theorie durch sich selbst sowie die konsequente Anwendung der Theorie auf sich selbst“ (2003, 24) zu gewährleisten. Dem Selbstverständnis des Autors zufolge ist also sein „Abschied vom Konstruktivismus“ kein Abschied von den „Ansprüchen konstruktivistischen Denkens“ (2003, 24). Statt dessen ist er als eine Kritik an den bisher mit dem Begriff Konstruktivismus verbundenen naturalistischen und/oder kulturalistischen Begründungsformen zu verstehen. An deren Stelle soll nun ein sich selbst begründender Konstruktivismus treten.
Der zentrale Unterschied zum „soziokulturellen Konstruktivismus“ (Schmidt 1994, 47) von 1994 lässt sich anhand der neuen Lösungsstrategie verdeutlichen, die der Autor in G&D zur „Vermittlung zwischen kognitiver Autonomie und sozialer Orientierung“ (2003, 25) vorschlägt. Mit „kognitiver Autonomie“ ist der Sachverhalt gemeint, dass die Setzungen, die ich mache, immer in einem strengen Sinn als „meine“ Setzungen zu klassifizieren sind, weil „Aktanten“ (also Menschen) - gemäß der von Schmidt nach wie vor geteilten Grundvoraussetzung des Konstruktivismus - „nur strikt systemspezifisch operieren können“ (2003, 62). Das, was ich sage, tue oder fühle, sage, tue oder fühle ich zwar gemäß kulturell einsozialisierter Setzungen und Voraussetzungen, die sich ausgehend von Wirklichkeitsmodellen und Kulturprogrammen bis in Geschichten und Diskurse hinein konkretisieren. Der kognitive Vollzug einer Handlung, eines Gedankens oder eines Gefühls aber ist als kognitiver Vollzug in meinem Kopf je individuell und insofern für niemanden außer mir selbst zugänglich oder nachvollziehbar.
Dieses Grundproblem des Konstruktivismus bleibt auch in der selbstbegründenden Theoriekonzeption erhalten. Aber unter den Bedingungen der „Geschichten&Diskurse-Philosophie“ (Schmidt 2003, 100) erscheint es als ein Problem, dessen neuartige Beschreibung zugleich seine Lösung impliziert. Die Verbindlichkeit des intersubjektiven Wirklichkeitsbezugs meiner Handlungen, Gedanken und Gefühle wird nämlich durch den generativen „Mechanismus der Reflexivität“ (2003, 103), der das komplexe Netzwerk von Setzungen/Voraussetzungen, Wirklichkeitsmodellen/Kulturprogrammen und Geschichten/Diskursen überhaupt erst ermöglicht, bereits ausreichend gesichert. Das „Konzept der strukturellen Kopplung“ (2003, 103), das bisher dazu diente, die systemspezifisch operierenden Kognitionen auf direkte Weise miteinander zu verbinden, wird dadurch überflüssig. Darin kommt eine der grundlegenden Differenzen zum Ausdruck, durch die sich der „als (...) postkonstruktivistisch erscheinen[de]“ (2003, Manuskriptfassung 110; in der Druckfassung vom Autor entfernt!) Konstruktivismus von G&D sowohl von den naturalistischen als auch von den kulturalistischen Argumentationsstrategien bisheriger Konstruktivismen unterscheidet.
Das eigentliche Herzstück von Schmidts neuem Buch stellt deshalb die Freilegung der reflexionstheoretischen Möglichkeitsbedingungen dar, auf denen das soziokulturelle Netzwerk von „Kontrollparameter[n]“ (2003, 102) basiert, mit dessen Hilfe sich individuelle Praxis je schon in soziale transformiert. Der Autor geht dabei so weit, dass er sowohl das raumzeitlich situierte Bewusstsein, den Aktanten und dessen Vergesellschaftung als auch das „Komplementaritätsverhältnis von Bewusstsein und Gegenstand“ (2003, 84) aus der „Logik von Setzung und Voraussetzung“ (2003, 37) ableitet. Diese Logik, die als ein autokonstitutiver Prozess wechselseitiger Generierung konzipiert ist, verweist auf die „nicht-dualistische“ (2003, 93) Basisstrategie, die Schmidts Theoriegebäude zugrunde liegt.
Die Strategie besteht darin, die „Probleme dualistischen Philosophierens durch eine bewusste Verschiebung des Startmanövers von Objekten zu Prozessen“ (Schmidt 2003, 144) aufzulösen. Die alten Oppositionen von Subjekt und Objekt, Aussage und Gegenstand, Schema und Inhalt werden auf diesem Weg prozessualisiert und im Hegelschen Sinn des Wortes in eine(r) höherstufige(n) Denkform ‚aufgehoben‘. Auf metatheoretischer Ebene resultiert daraus der Anspruch, das konstruktivistische Grundanliegen jenseits der Opposition von Realismus/Antirealismus neu zu definieren. Die Geschichten&Diskurse-Philosophie präsentiert sich insofern durchaus zu Recht als „Abschied vom Konstruktivismus“. Denn das tragende Selbstverständnis des bisherigen Konstruktivismus speist sich zu wesentlichen Teilen aus seiner Opposition zum Realismus.
Schmidts Selbstverortung „im Rahmen nicht-dualistischer philosophischer Ansätze“ (2003, 92) lässt neben Josef Mitterer und Peter Janich, auf die der Autor explizit Bezug nimmt, vor allem an die pragmatistischen Strömungen modernen Philosophierens denken, die gegenwärtig eine internationale Renaissance erfahren (Sandbothe 2000 und 2003a). So präsentiert Richard Rorty - einer der Hauptvertreter des amerikanischen Neopragmatismus – die von ihm im Anschluss an John Dewey und Donald Davidson vertretene Position als dezidiert antidualistisch. Im Unterschied zu Schmidt meint Rorty damit jedoch ein Denken, das sich auf erkenntnistheoretische Fragestellungen nicht mehr konstruktiv und systematisch, sondern nur noch destruktiv und therapeutisch einlässt. Deshalb entwickelt Rorty auch kein komplexes Verfahren der Prozessualisierung von Ich und Welt, sondern schlägt schlicht und einfach vor, erkenntnistheoretische Probleme aller Art rigoros beiseite zu schieben. An die Stelle der epistemologischen Lehrbuchfrage nach den „Bedingungen der Möglichkeit von X“ sollten seiner Ansicht nach ganz andere (nämlich unmittelbar soziopolitisch relevante) Themenfelder treten (Rorty 1999).
Anders Schmidt. Aus seiner Sicht kann und soll das eine - nämlich die demokratische Ausrichtung einer pragmatistisch verstandenen Wissenschaft - das andere - also die (reflexionstheoretisch prozessualisierte) Erkenntnistheorie - keinesfalls ausschließen oder gar ersetzen. Dem Nachweis der inneren Verwobenheit beider Bereiche dienen die Kapitel 11 bis 14 des vorliegenden Buchs, in denen es um personale und soziale Identität, Moral und Wahrheit geht. Darin führt Schmidt vor Augen, wie sich das Zusammenspiel von Setzungen und Voraussetzungen, Wirklichkeitsmodellen und Kulturprogrammen, Geschichten und Diskursen als gesellschaftlicher Prozess unter den reflexiven Bedingungen der wechselseitigen Beobachtung von Aktanten vollzieht.
Um Schmidts Konzeption, der zufolge Identität, Moral und Wahrheit als „Orientierungs-Orientierungen“ (2003, 102) zu beschreiben sind, angemessen in den Blick zu bekommen, muss man sich zunächst klar machen, dass es einer nichtdualistischen Philosophie im Schmidtschen Sinn nicht um den wie auch immer gearteten Realitätsstatus von Setzungen und Voraussetzungen, Wirklichkeitsmodellen und Kulturprogrammen, Geschichten und Diskursen geht. Statt dessen werden diese sinnerzeugenden Strukturen zu „operative[n] Fiktion[en]“ (2003, 33) verflüssigt, die ihre pragmatische Wirksamkeit durch die wechselseitige Zuschreibung erlangen, mittels derer Aktanten anderen Aktanten moralische Handlungsregeln, verifizierbare Wissensbestände und affektiv besetzte Identitäten unterstellen.
Das ist ein geschickter Schachzug. An die Stelle eines barocken Systems von symbolischen Ordnungen erster, zweiter und dritter Seinsstufe treten so intersubjektive Zuschreibungspraktiken, die man nach verschiedenen Hinsichten beobachten kann. In Sachen Moral führt das dazu, diese als „Geschichten&Diskurse gebundene Anwendung von sittlichen Orientierungsprinzipien“ (Schmidt 2003, 122) zu konzipieren. Dabei erscheinen die sittlichen Prinzipien nicht als „Normen universeller Art“ (Schmidt, 2003, 122), die einer ethischen (also theoretischen) Begründung bedürften, sondern als autokonstitutive Zuschreibungspraktiken, die sich in ihrer handlungsleitenden Funktion in einer bestimmten Kultur jeweils als „pragmatischer Legitimationsunterbrecher“ (2003, 122) bewähren oder nicht.
Ähnlich geht Schmidt in Sachen „Wahrheit“ vor. Sie wird bestimmt als Einheit der Differenz wahr/falsch und dient dazu, „Aussagenverlässlichkeit in Geschichten und Diskursen“ (2003, 128) sicherzustellen. Das geschieht zum einen durch die billigende Verwendungsweise von ‚wahr/falsch’ als „Argumentationsunterbrecher durch die Legitimität der Bezugnahme auf den Status quo des gemeinsamen Wissens“ (2003, 128); und es geschieht zum anderen durch die warnende Verwendungsweise von ‚wahr/falsch’, die sicherstellt, dass „zu jeder Zeit eine Wiederaufnahme der Wahrheitsbegründung eingefordert werden kann“ (2003, 129). Beide Verwendungsweisen sind in der pragmatistischen Philosophie des 20. Jahrhunderts herausgearbeitet und als Alternativen zu den klassischen Wahrheitskonzepten ins Spiel gebracht worden, welche versuchen, die Konsensfähigkeit einer Aussage im Rekurs auf ihre als Korrespondenz verstandene Wahrheit zu erklären (Davidson/Rorty 2004 und Sandbothe 2003b).
In Sachen Moral und Wahrheit argumentiert Schmidt ohne Abstriche als Pragmatist. Komplexer ist die Lage bei der Identität. Sie fungiert als strukturelle Voraussetzung für die Zuschreibung der beiden orientierungsgebenden Differenzen von wahr/falsch und gut/böse, deren reflexive Dynamik von Schmidt auch als wissensbezogene „Erwartungs-Erwartung“ (2003, 115) und wertbezogene „Unterstellungs-Unterstellung“ (2003, 115) beschrieben wird. Zwar handelt es sich auch bei der Identität um eine Zuschreibung und insofern um eine operative Fiktion. Aber im Unterschied zu Wahrheit und Moral sind persönliche (Ego/Alter) und gesellschaftliche Identität (Wir/die Anderen) aus Schmidts Sicht nicht nur als Netzwerke von Zuschreibungen zu begreifen, sondern darüber hinaus auch als Bedingungen der Möglichkeit von Zuschreibung überhaupt.
Das ist Schmidt zufolge deshalb notwendig, weil das identische Ich „der Ausgangspunkt aller Bezugnahmen des Bewusstseins und der Referenzbereich für die Selbstzuschreibung von Intentionen, Handlungsfähigkeit, Willen usw.“ (2003, 105) ist. Das Verhältnis von Ego und Alter beschreibt Schmidt als einen Prozess der wechselseitigen Selbstsetzung, um auf diesem Weg die formale Ich-Identität (analog dem Bewusstsein und seiner Gegenstände) aus der Logik von Setzung und Voraussetzung ableiten zu können. Erst mit Blick auf ihre „Spezifik“ wird die Identitätsbildung dann in einem zweiten Schritt auf die „Selektivität von Geschichten und Diskursteilnahmen von Aktanten sowie auf deren Phantasie und Kreativität“ (2003, 110) zurückbezogen. Eben darin liegt die Differenz zum pragmatistischen Identitätskonzept, demzufolge „eine Person nichts anderes ist als eine kohärente und plausible Menge von Überzeugungen und Wünschen“ (Rorty 1988, 44).
Die Nähe von Schmidts Geschichten&Diskurse-Philosophie zu pragmatistischen Denkmotiven ist deutlich geworden. Zugleich aber ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Nähe auf Detailfragen der Durchführung und nicht auf die Anlage des Gesamtunternehmens bezieht. Die Differenz in der Anlage spiegelt sich in dem Detailunterschied, der zwischen Schmidts Identitätskonzept und dem pragmatistischen Personenmodell besteht. Während Schmidt Wahrheit und Moral unter den als vorgängig konzipierten Bedingungen von Geschichten und Diskursen denkt, bestimmt er Identität zunächst und primär als formale Möglichkeitsbedingung von Geschichten und Diskursen und erst sekundär und in inhaltlicher Hinsicht als deren Realisierung. Darin kommt zum Ausdruck, dass Schmidt von einer Fundierungsdimension her denkt, die zwar auf Geschichten und Diskurse hin angelegt ist, diese jedoch zugleich auch transzendiert. Dabei handelt es sich um den bereits erwähnten „autokonstitutiven Zusammenhang von Setzung (...) und Voraussetzung (...)“ (2003, 29).
Die von Schmidt auf Hegel zurückgeführte Logik dieses Zusammenhangs dient ihm dazu, „die vollständige Begründung der Theorie durch sich selbst sowie die konsequente Anwendung der Theorie auf sich selbst“ (2003, 24) zu gewährleisten. Das in dieser Auffassung zum Ausdruck kommende Theorieverständnis läuft dem Theorieverständnis des Pragmatismus diametral entgegen. Der Pragmatist schlägt vor, den theoretischen Anspruch auf Selbstbegründung und Selbsterklärung, der das philosophische Denken lange Zeit geprägt hat, durch ein soziopolitisches Nützlichkeitskriterium zu ersetzen. Zwar stellt sich auch Schmidt im Schlusskapitel seines Buchs die pragmatistische Frage „Wozu eine Theorie der Geschichten&Diskurse?“ (2003, 143). Doch im Unterschied zum Rortyschen Pragmatisten setzt Schmidt die unterschiedlichen Nützlichkeitskriterien, die sich aus den soziopolitischen Wertestandards moderner Demokratien ergeben, nicht einfach als kontingenten Bewertungsrahmen voraus. Statt dessen erhebt er den Anspruch, mit seiner Geschichten&Diskurse-Philosophie das erkenntnistheoretische Fundament für „eine grundsätzliche Entscheidung für demokratische Formen gesellschaftlichen Lebens“ (2003, Manuskriptfassung 104; in der Druckfassung vom Autor entfernt!) zu legen.
Es ist kein Zufall, dass Schmidt in diesem Zusammenhang auf Probleme von „Multikulturalität und Globalisierung“ (2003, 148) zu sprechen kommt. Denn gerade in ihrem Außenverhältnis scheinen demokratische Gesellschaften unter den Bedingungen ihrer Globalisierung guter Argumente zu bedürfen, um die Mitglieder nicht-demokratischer Gesellschaften von den Vorteilen ihrer Demokratisierung zu überzeugen. Ob der theoretische Rekurs auf den autokonstitutiven Zusammenhang von Setzungen&Voraussetzungen, Wirklichkeitsmodellen&Kulturprogrammen und Geschichten&Diskursen eine solche transkulturelle Überzeugungskraft tatsächlich entfalten kann, wird die Zukunft zeigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schmidt sich mit seinem Buch gezielt an ein intellektuelles, kulturwissenschaftlich geschultes und im konstruktivistischen Denken geübtes Publikum wendet. Seine Nützlichkeitserwägungen beziehen sich auf die Wirkungen, welche die Geschichten&Diskurse-Philosophie auf ausgewählte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (und vermittelt über diese dann auf Entscheiderinnen und Entscheider in der globalen Wirtschaft und Politik) entfalten kann.
Berücksichtigt man diese realistische Einschätzung der möglichen Wirkungsweise des vorliegenden Werks, dann lässt sich Schmidts Ansatz auch und gerade aus pragmatistischer Perspektive als zukunftsweisend verstehen. Denn die meisten derjenigen zeitgenössischen Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, die in ihrer akademischen Ausbildung durch aufklärungs- und demokratiekritische Denkschulen geprägt worden sind - und das sind nicht wenige! -, lassen sich wohl am ehesten durch strenge reflexionstheoretische Argumentationsfiguren dazu bewegen, dem demokratischen Grundanliegen und den damit verbundenen soziopolitischen Fragestellungen in ihrer Arbeit wieder eine stärkere Bedeutung zu geben. Insofern kann man nur hoffen, dass der Geschichten&Diskurse-Philosophie im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine ebenso wirksame Rezeption zuteil wird wie dem Radikalen Konstruktivismus im letzten Jahrzehnt des vergangenen Millenniums.
Zitierte Literatur
Davidson, Donald / Rorty, Richard (2004): Wozu Wahrheit? Eine Debatte, hrsg. von Mike Sandbothe, Frankfurt/M.: Suhrkamp (im Druck).
Janich, Peter (1992): „Die methodische Ordnung von Konstruktionen. Der Radikale Konstruktivismus aus der Sicht des Erlanger Konstruktivismus“, in: Schmidt (Hg.), 1992, S. 24-41.
Rorty, Richard (1988): Solidarität oder Objektivität?, Stuttgart: Reclam.
Rorty, Richard (1999): Philosophy and Social Hope, London und New York: Penguin.
Sandbothe, Mike (2000) (Hg.): Die Renaissance des Pragmatismus. Aktuelle Verflechtungen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Sandbothe, Mike (2003a): „Medien – Kommunikation - Kultur. Grundlagen einer pragmatischen Kulturwissenschaft“, in: Kulturwissenschaft als Kommunikationswissenschaft: Projekte, Probleme, Perspektiven, hg. von Matthias Karmasin und Carsten Winter, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 257-271.
Sandbothe, Mike (2003b): „Davidson and Rorty on Truth: Reshaping Analytic Philosophy for a Transcontinental Conversation“, in: A House Divided: Comparing Analytic and Continental Philosophers, hg. von Carlos G. Prado, Amherst (NY): Humanity Books, S. 235-258.
Schmidt, Siegfried J. (1982a): „Unsere Welt – und das ist alles“, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Heft 4, Jahrgang 36, April 1982, S. 356-366.
Schmidt, Siegfried J. (1982b): „Einladung, Maturana zu lesen“, in: Humberto R. Maturana, Erkennen: die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig und Wiesbaden: Vieweg 1982, S. 1-10.
Schmidt, Siegfried J. (1987) (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Schmidt, Siegfried J. (1992) (Hg.): Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Schmidt, Siegfried J. (1994): Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Schmidt, Siegfried J. (2000): Kalte Faszination. Medien-Kultur-Wissenschaft in der Mediengesellschaft, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Schmidt, Siegfried J. (2003): Geschichten und Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Schmidt, Siegfried J. / Zurstiege, Guido (2000): Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, was sie will, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.