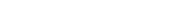in: Handbuch der Kulturwissenschaften. Bd. 2 Grundlagen und Schlüsselbegriffe , hrsg. von Friedrich Jaeger und Burkhard Liebsch, Stuttgart und Weimar: Metzler 2004 sowie in: Kulturwissenschaft als Kommunikationswissenschaft: Projekte, Probleme, Perspektiven, hrsg. von Matthias Karmasin und Carsten Winter, Opladen: Westdeutscher Verlag 2003, S. 257-271.
Mike Sandbothe
Medien - Kommunikation - Kultur
Grundlagen einer pragmatischen Kulturwissenschaft
Bei den drei im Titel genannten Begriffen Medien, Kommunikation und Kultur handelt es sich um grundlegende Konzepte, die heute weite Teile der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung prägen und zum Teil neu strukturieren. Mit Blick auf die Geisteswissenschaften haben Wolfgang Frühwald, Hans Robert Jauß, Reinhard Koselleck, Jürgen Mittelstraß und Burkhart Steinwachs bereits 1991 eine kulturwissenschaftliche Wende in Forschung und Lehre prognostiziert,1 und angesichts der zunehmenden Medialisierung und Globalisierung moderner Gesellschaften kann man mit Blick auf die Sozialwissenschaften beobachten, dass die empirisch verfahrende Publizistik- und Kommunikationswissenschaft zunehmend den Anspruch einer neuen sozialwissenschaftlichen Leitdisziplin erhebt.2 Zugespitzt formuliert bedeutet das: Die Geisteswissenschaften reorganisieren sich derzeit am Leitfaden des Paradigmas der Kultur, und die Sozialwissenschaften reorganisieren sich derzeit am Leitfaden des Paradigmas der Kommunikation.
Die Medienwissenschaft steht im Brennpunkt dieser beiden wissenschaftlichen Mega-Trends, die sich keinesfalls auf Deutschland beschränken, sondern auch in anderen europäischen Ländern und in den USA auf dem Vormarsch sind. Die theoretisch anspruchsvollen, ästhetisch und aisthetisch ausgewiesenen und historisch fundierten Methoden und Perspektiven der zeitgenössischen Medienwissenschaft entstammen vor allem den philologischen, philosophischen, kunst-, theater- und musikwissenschaftlichen Disziplinen; ihr zentrales Thema – die Medien – verweist auf ein in permanentem Wandel begriffenes Apriori von Kommunikation, mit dessen Hilfe sich unser kulturelles Selbstverständnis nicht nur rekonstruieren, sondern in the long run auch kreativ gestalten lässt.
Die folgenden Ausführungen gliedern sich in drei Teile. Der erste Teil befasst sich mit der für die wissenschaftstheoretische Grundlegung der Medienwissenschaft zentralen Frage, ob und wie der Medienbegriff zu definieren ist. Im zweiten Teil wird der Zusammenhang skizziert, der zwischen der modernen Mediengeschichte, die vom Buchdruck über die elektronischen Medien bis zum Internet reicht, und der Entwicklung wissenschaftlicher Kommunikationstheorien besteht. Vor diesem Hintergrund geht es im dritten Teil abschließend um die Frage, wie sich die medienhistorische Rekonstruktion der modernen Kommunikationstheorien in den umfassenden Horizont einer pragmatischen Kulturwissenschaft einbetten lässt.
1. Gebrauchstheoretische Überlegungen zur Definition des Medienbegriffs
In der wissenschaftstheoretischen Grundlagendebatte, die gegenwärtig über die begrifflichen Fundamente der Medienwissenschaft geführt wird, vertreten Autorinnen und Autoren wie Sybille Krämer, Martin Seel oder Matthias Vogel die Ansicht, dass die analytische Bewährungsprobe der medienwissenschaftlichen Grundlagenforschung in der Entwicklung einer begrifflich strengen Definition des Medienbegriffs bestehe.3 Demgegenüber habe ich in meinem Buch Pragmatische Medienphilosophie hervorgehoben, dass es aus der Perspektive einer gebrauchstheoretischen Bedeutungstheorie wenig sinnvoll erscheint, ein Merkmal zu suchen bzw. definitorisch festzulegen, das allen (bzw. den mit seiner Hilfe dann als medienwissenschaftlich legitim auszuzeichnenden) Verwendungsweisen des Wortes Medium gemeinsam wäre. Statt dessen plädiere ich mit dem späten Wittgenstein für eine Analyse der "Familienähnlichkeiten",4 die zwischen den im alltäglichen Sprachgebrauch und in den Wissenschaften etablierten unterschiedlichen Verwendungsweisen des Wortes bestehen.5
Aus gebrauchstheoretischer Sicht sind aus diesem Gesamtspektrum von Verwendungsweisen drei für die medienwissenschaftliche Forschung und Lehre besonders wichtige Anwendungsbereiche des Medienbegriffs hervorzuheben. Wir verwenden das Wort Medium erstens mit Blick auf sinnliche Wahrnehmungsmedien wie Raum und Zeit; wir beziehen es zweitens auf semiotische Kommunikationsmedien wie Bild, Sprache, Schrift oder Musik; und wir gebrauchen es drittens zur Bezeichnung von technischen Verbreitungs-, Verarbeitungs- und/oder Speichermedien wie Buchdruck, Radio, Film, Fernsehen, Computer oder Internet.6
Bei den genannten Beispielen handelt es sich jeweils um offene Reihen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. So kommen neben den Anschauungsformen von Raum und Zeit im Bereich der Wahrnehmungsmedien insbesondere die Sinnesorgane mit ins Spiel. Entsprechend sind zu den Verbreitungs-, Verarbeitungs- und/oder Speichermedien die Artikulationsorgane, das Gehirn, aber auch der Körper, das Licht und der Schall sowie Stein, Papyrus, Maske, Fotographie, Funk, Telefon oder Video zu rechnen. Und die Kommunikationsmedien umfassen neben den exemplarisch genannten auch die Zeichensysteme der Geräusche, der Gerüche, der Geschmäcke, der Berührungen sowie Gestik, Mimik, Tanz oder Theater bzw. das mathematische System der Zahlen.
Während Mediendefinitionen im klassischen Stil im Regelfall eine der drei Mediensorten als Definiensbereich auszeichnen, von dem her die anderen Bereiche medientheoretisch bestimmt oder exkludiert werden, legt eine gebrauchstheoretisch ausgerichtete Untersuchung den Schwerpunkt auf die dynamischen Interferenzen, die zwischen Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Verbreitungsmedien bestehen. Deren Berücksichtigung charakterisiert eine dezidiert transdisziplinäre Konzeption medienwissenschaftlicher Forschung. In ihrem Zentrum steht die intermedialitätstheoretische Frage, wie Veränderungen im Bereich der Verbreitungs-, Verarbeitungs- und/oder Speichermedien zu Transformationen von Nutzungsgewohnheiten im Bereich der Kommunikationsmedien führen und wie diese wiederum zu einer Reorganisation unserer Wahrnehmungsmedien und damit verbunden der aisthetischen und epistemologischen Grundlagen unseres kulturellen Selbst- und Weltverständnisses beitragen können.7
Zusätzlich und querlaufend zur Binnendifferenzierung des Medienbegriffs in Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Verbreitungsmedien ist es aus gebrauchstheoretischer Sicht hilfreich, zwischen pragmatischen und theoretischen Verwendungsweisen des Medienbegriffs zu unterscheiden. Diese Differenz ist dem Wort Medium bereits etymologisch eingeschrieben.8 Während das lateinische "medius" noch primär das in einem räumlichen Sinn "in der Mitte Befindliche", "Dazwischenliegende" bezeichnet, entwickelt das seit dem 17. Jahrhundert in der deutschen Sprache nachweisbare Fremdwort im 18. Jahrhundert zwei unterschiedliche Bedeutungsfelder. Innerhalb des ersten, eher pragmatisch auszubuchstabierenden Bedeutungsfelds fungiert "Medium" als Wort zur Bezeichnung für "das, was zur Erreichung eines Zweckes dient", d.h. "Medium" wird hier (ausgehend von naturwissenschaftlichen Verwendungsweisen) im Sinn von "Mittel", "Hilfsmittel" und "Werkzeug" gebraucht. Innerhalb des zweiten, eher theoretisch auszubuchstabierenden Bedeutungsfelds, das sich aus dem ersten ableitet und dann verselbständigt, bezeichnet "Medium" "das zwischen zwei Dingen Vermittelnde", d.h. "Medium" wird im Sinn von "Mitte", "Mittler", "Mittelglied", und "vermittelndes Element" verwendet (Wahrnehmungstheorie, Spiritismus, Mesmerismus).9 Diese Doppeldeutigkeit spiegelt sich bis in die sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts etablierende Bedeutung von "Medien" und "Massenmedien" als (pragmatisch verstandene) "Kommunikationsmittel" bzw. als (theoretisch verstandene) "Informationsvermittler, Information vermittelnde Einrichtungen".10
Gebrauchstheoretisch ergibt sich aus dieser doppelten Begriffsgeschichte der Vorschlag, die medienwissenschaftlichen Verwendungsweisen des Wortes Medium nicht auf den semantischen Vermittlungsaspekt zu reduzieren, sondern darüber hinaus den Werkzeugcharakter von Medien ernst zu nehmen. Das ist in der einschlägigen Forschung keinesfalls selbstverständlich. Tendieren doch nach wie vor viele Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler dazu, Medien allein durch ihre semantische Vermittlungsfunktion zu bestimmen. Diese wird dann entweder mit Blick auf die bedeutungsvermittelnden Kommunikatoren, den durch Bedeutung vermittelten Gegenstand oder den als Bedeutung vermittelten Gehalt spezifiziert.
Die einseitige Fokussierung auf semantische Probleme führt dazu, dass die Frage in den Hintergrund tritt, welchem Zweck die Bedeutungsvermittlung dient. Um dieses Defizit zu beheben, wird Bedeutungsvermittlung im Rahmen des gebrauchstheoretischen Medienbegriffs als eine Funktion von Handlungskoordination aufgefasst. Das heißt: Medien werden der Gattung der Werkzeuge zugeordnet und als Instrumente zur Veränderung von Wirklichkeit aufgefasst. Die spezifische Differenz zu anderen Arten von Werkzeugen ergibt sich dabei durch den Sachverhalt, dass Medien im Unterschied zu anderen Werkzeugen nicht nur dazu dienen, Wirklichkeit zu verändern. Ihre Aufgabe besteht darüber hinaus darin, wirklichkeitsveränderndes Handeln intersubjektiv zu koordinieren. Eine gebrauchstheoretische Mediendefinition würde daher lauten: Medien sind Werkzeuge, die der Koordination zwischenmenschlichen Handelns dienen. Sie helfen uns dabei, die Vokabulare zu optimieren oder neu zu erfinden, die wir zu Zwecken der privaten und öffentlichen Selbstbeschreibung verwenden.
Eine ausführliche theoretische Begründung dieser Definition ließe sich sicherlich nachliefern. Im vorliegenden Kontext erscheint mir jedoch die naheliegende Intuition ausreichend, dass der gebrauchstheoretische Medienbegriff, würde er sich inner- und außerakademisch weiter durchsetzen, zur Optimierung der demokratischen Kultur sich globalisierender Mediengesellschaften einen wichtigen Beitrag leisten könnte. Ich werde darauf im dritten Teil meiner Ausführungen zurückkommen. Zuvor aber möchte ich auf den historischen Zusammenhang eingehen, der zwischen Medien und Kommunikation besteht.
2. Mediengeschichte und Kommunikationstheorien
Michael Giesecke hat in seinen Arbeiten zur Geschichte des Buchdrucks in der frühen Neuzeit zu zeigen versucht, dass der moderne Kommunikationsbegriff implizit am Leitfaden der für den Buchdruck charakteristischen Struktur von Interaktion konzipiert worden ist.11 Der Zusammenhang, den er zwischen dem technischen Verbreitungsmedium des Buchdrucks und der am Leitfaden des semiotischen Kommunikationsmediums der Sprache begriffenen Struktur von Kommunikation sieht, wird von Giesecke am Beispiel des Konzepts der langue verdeutlicht. Dieses ist von Ferdinand de Saussure zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt worden.12
Bereits Saussures Fokussierung auf Sprache als ausgezeichnetes Medium der Kommunikation ist Giesecke zufolge ein Effekt der neuzeitlichen Prämierung des Buchdrucks als vorherrschendes Verbreitungsmedium. Der Buchdruck transportiert zunächst in erster Linie Sprache; vereinzelt zwar auch Zeichnungen und später fotographische Bilder, aber keine Klänge, Gerüche, Gesten, Bewegungen oder Berührungen. Darüber hinaus wird die als Schrift visualisierte Sprache erst durch den Buchdruck als quasi-materieller Forschungsgegenstand konstituiert. Die mediale Interferenz von gesprochener und als Schrift gedruckter Kommunikation macht Giesecke zufolge überhaupt erst den modernen Gedanken möglich, dass der Vielzahl der unterschiedlichen und flüchtigen Sprechakte, die Menschen in konkreten Situationen zum Zweck der intersubjektiven Koordination von Handlungen vollziehen, ein einheitliches System namens Sprache zugrunde liegen könnte. Eben dieses System aber habe Saussure im Blick gehabt, als er das abstrakte Konzept der langue von den konkreten Sprachverwendungen der parole unterschied und damit die neue wissenschaftliche Disziplin der Linguistik begründete.
Die von mir oben (mit Blick auf den Medienbegriff) bereits erwähnte Auffassung von der Definition als Festlegung der Bedeutung eines Wortes, die alle kontingenten Verwendungsweisen an ein sich durchhaltendes Merkmal zurückbinden soll, lässt sich Giesecke zufolge als theoretische Extrapolation typographischer Praktiken auf den am Leitfaden der Sprache verstandenen Kommunikationsbegriff interpretieren. In diesem Sinn stellt Giesecke heraus, dass sich "die 'standardsprachlichen' Bedeutungen in unseren Wörterbüchern [...] auf ein, allerdings sehr großes und mit imperialistischem Anspruch auftretendes massenmediales Kommunikationssystem zurückführen [lassen]".13
Tatsächlich ist die Einführung der nationalen Standardsprachen in engem Zusammenhang mit der Bestrebung zu sehen, die durch Industrialisierung und Buchdruck geschaffenen überregionalen Distributionsmöglichkeiten durch Vereinheitlichung der regionalen Sprachverhältnisse realisierbar zu machen. Die ersten deutschen Wörterbücher und Grammatiken wurden im 16. Jahrhundert als Gebrauchsanleitungen verfasst, die Skribenten, welche für das Typographeum schrieben, zu beachten hatten, um gedruckt zu werden. Die Verfasser dieser Druckvorschriften ließen sich dabei von der arbeitsökonomischen Annahme leiten, dass es eine endliche Zahl von Stammwörtern gebe, die sich durch morphologische Ableitungsregeln vermehren und durch grammatikalische Regelsysteme zu sinnvollen Sätzen verbinden lassen.
Bereits die diesen Annahmen zugrundeliegenden Vorstellungen von durch Spatien getrennten Einzelwörtern und von durch Punkten getrennten Einzelsätzen konnten sich jedoch, wie Giesecke überzeugend herausarbeitet, erst unter Buchdruckbedingungen breitenwirksam durchsetzen.14 Im Laufe der Zeit sind diese typographischen Gewohnheiten derart prägend für unser Bild von Sprache und Kommunikation geworden, dass Wissenschaftler wie Saussure, Bühler oder Chomsky sie zu Grundlagen und Axiomen einer allgemeinen Kommunikationstheorie stilisierten. Diese wurden dann vermeintlich medienneutral als Bedingungen der Möglichkeit von Verständigung überhaupt begriffen.15
Im 19. Jahrhundert war es die Ausbreitung der Fotographie und im 20. Jahrhundert zunächst das Kino und dann vor allem die Etablierung der elektronischen Massenmedien Radio und Fernsehen, die zur Veränderung der wissenschaftlichen Kommunikationsparadigmen einen wichtigen Beitrag leisteten. Gerold Ungeheuer hat auf diese Zusammenhänge in einem Aufsatz hingewiesen, der 1987 unter dem Titel "Vor-Urteile über Sprechen, Mitteilen und Verstehen" erschienen ist. Darin arbeitet er heraus, "dass sich in den letzten Jahrzehnten unter nur zu bekanntem Einfluss ein 'Transportmodell' der Kommunikation breit gemacht hat, das mit 'Sender', 'Empfänger', 'Kodierung' und 'Dekodierung' terminiert ist".16 Was Ungeheuer im Blick hat, ist das von Shannon und Weaver in den vierziger Jahren entwickelte informationstechnische Modell der Kommunikation. Innerhalb der modernen Publizistik- und Kommunikationswissenschaft hat es noch bis vor kurzem als kanonisch gegolten.17
Erst durch die systemtheoretische Rekonfiguration des Kommunikationsbegriffs, die sich mit dem Namen Niklas Luhmann verbindet, sind die theoretischen Mängel des Sender-Empfänger-Modells mehr oder weniger flächendeckend ins Bewusstsein gerückt worden. In seinem frühen Hauptwerk Soziale Systeme schreibt Luhmann mit Blick auf Shannon und Weaver: "Die Übertragungsmetapher ist unbrauchbar, weil sie zuviel Ontologie impliziert. Sie suggeriert, dass der Absender etwas übergibt, was der Empfänger erhält."18 Und Luhmann fährt fort: "Die Übertragungsmetapher legt das Wesentliche der Kommunikation in den Akt der Übertragung, in die Mitteilung. Sie lenkt die Aufmerksamkeit [...] auf den Mitteilenden."19
Dieser subjektzentrierten Sichtweise stellt die Systemtheorie eine alternative Perspektive gegenüber. Im Zentrum von Kommunikation steht ihr zufolge die Erzeugung von Sinn. Letztere wird von Luhmann durch ein Drei-Selektionen-Modell beschrieben. Dieses tritt an die Stelle des Zwei-Personen-Modells, das den kleinsten gemeinsamen Nenner von Buchdruckparadigma – Setzer und Leser als Sprecher und Hörer – und Rundfunkparadigma – Sender und Empfänger als Kommunikator und Rezipient – ausmacht. Die miteinander kommunizierenden Personen werden systemtheoretisch durch Information, Verstehen und Mitteilung ersetzt. Dabei handelt es sich um die drei grundlegenden Selektionsprozesse, mit deren Hilfe sich ein Kommunikationssystem als Kommunikationssystem konstitutiert.
Im Unterschied zu Shannon und Weaver hat Luhmann jedoch nicht immer ausreichend deutlich gemacht, wie stark seine Theorie durch ein bestimmtes technisches Leitmedium geprägt ist. Der Computer ist ein Medium, das Information prozessiert, ohne dass Sender und Empfänger als Subjekte dabei in technischer Hinsicht eine zentrale Rolle spielen. Diese werden vielmehr in der apparativen Logik des Computers durch Prozessoren ersetzt. Die am Leitfaden des digitalen Prozessierens von Information begriffene Kommunikation wird daher selbstreferentiell. Kommunikation kommuniziert Kommunikation. Das ist der Grundgedanke von Luhmanns autopoietischer Kommunikationstheorie, deren technisches Leitmedium nicht der Buchdruck, das Kino, das Radio oder das Fernsehen ist, sondern die digitale Datenmaschine.
Erst die Ausbreitung des Internets hat dazu geführt, dass die medientheoretischen Voraussetzungen und – damit eng verbunden – die konzeptionellen Grenzen der Systemtheorie stärker ins Bewusstsein der wissenschaftlichen Öffentlichkeit getreten sind. So hebt Manfred Faßler in seinem Buch Netzwerke mit Blick auf das Internet hervor, dass "die Gesprächslage über Medien von der Fixierung auf das politisch-publizistische System der Meinungsbildung und Informationsverarbeitung hin zur sozial-konstitutiven Rolle der elektronischen, programmierten Netzwerke verlegt [wird]".20 Und Volker Grassmuck geht noch einen Schritt weiter, wenn er schreibt: "Es macht Sinn, jetzt das Soziale von den Netzen her zu denken."21
Soweit meine kurze Skizze der Zusammenhänge, die sich vom Buchdruck bis zum Internet zwischen der Mediengeschichte und der Etablierung bestimmter wissenschaftlicher Kommunikationstheorien rekonstruieren lassen. Am Ende dieser Rekonstruktion stellt sich zum einen die von Faßler und Grassmuck mehr oder weniger offen gelassene Frage, wie eine soziale Kommunikationstheorie konkret aussehen könnte, die sich am Leitfaden der digitalen Netzwerke orientiert. Darüber hinaus und zum anderen eröffnet die kritische Reflexion auf die Zusammenhänge, die zwischen wissenschaftlichen Theorien und mediengeschichtlichen Veränderungen bestehen, einen über die erstgenannte Frage noch hinausgehenden Problemhorizont. Dieser ergibt sich aus der medienhistorischen Relativierung des Gesamtprojekts einer allgemeinen Kommunikationstheorie, die sich umwillen begrifflicher Vereinheitlichung implizit oder explizit an einem bestimmten technischen Leitmedium ausrichtet. Der Frage nach einer Sozialtheorie des Internet bin ich an anderer Stelle ausführlich nachgegangen.22 Im folgenden geht es um das Problem, wie Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler ohne die Standardisierungsleistungen einer allgemeinen Kommunikationstheorie auskommen können.
3. Grundlagen einer pragmatischen Kulturwissenschaft
Die Begriffe Kultur und Kommunikation sind in der aktuellen Debatte um das professionelle Selbstverständnis der kulturwissenschaftlichen Disziplinen eng miteinander verzahnt. Kultur wird als ein ausgezeichneter Raum symbolischer Ordnungen begriffen, der sich in und durch Kommunikation konstituiert. Die mediengeschichtliche Problematisierung des Projekts einer allgemeinen Kommunikationstheorie wirkt sich auf die Kulturwissenschaften und ihr Selbstbild aus. Im Unterschied zu den angelsächsischen Ländern, wo die Cultural Studies bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als eigene Studiengänge und/oder Fächer eingerichtet worden sind, gewinnt die kulturwissenschaftliche Reorganisation der Geisteswissenschaften an deutschen Hochschulen erst neuerdings an institutioneller Konkretion. In dieser Verspätung liegt zugleich eine besondere Herausforderung. Statt die angelsächsischen Konzepte einfach zu kopieren, die in den englischen und amerikanischen Universitäten zu einer Zeit entwickelt worden sind, als das Projekt einer allgemeinen Kommunikationstheorie noch hoch im Kurs stand, besteht jetzt die Möglichkeit, die akademische Institutionalisierung der Kulturwissenschaften mit einer zeitgemäßen Transformation des Kulturbegriffs zu verbinden. Zu diesem Zweck ist es hilfreich, einen Blick auf das bisher vorherrschende Verständnis von "Kultur" zu werfen.
Um zu bestimmen, welcher Kulturbegriff in den modernen Kulturtheorien verwendet wird, hat Andreas Reckwitz vier wirkungsmächtige Traditionen unterschieden: den normativen, den totalitätsorientierten, den differenzierungstheoretischen und den bedeutungs- und wissensorientierten Kulturbegriff.23 Gemeinsam ist allen vier Traditionen die "Tendenz zu einem traditionalistischen Homogenitätsbegriff der Kultur".24 Darauf hat auch Wolfgang Welsch hingewiesen. Seiner Analyse zufolge lassen sich nicht nur die ethnische Fundierung und der interkulturelle Separatismus, die für normative und universalistische Kulturtheorien kennzeichnend sind, sondern auch der Multikulturalismus, der sich mit differenztheoretischen Ansätzen verbindet, als Effekte des Homogenitätsaxioms deuten. Denn auch und gerade die Vertreter multikulturalistischer Konzepte gehen von primär homogenen und sich erst sekundär hybridisierenden Einzelkulturen aus.25
Das kulturelle Homogenitätsaxiom, das Reckwitz und Welsch aus einer ideengeschichtlichen Perspektive problematisieren, wird von Giesecke in seinem transmedialen Publikationsprojekt Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft auf die Art und Weise zurückgeführt, wie die modernen Industriegesellschaften den "Buchdruck als Wunschmaschine"26 vermarktet haben. Diese Gesellschaften prämieren ein Kulturkonzept, das in dreifacher Hinsicht auf Homogenität basiert. Erstens wird Kultur als homogenes System einheitlicher Regeln begriffen. Zweitens werden diese Regeln in Bildungsinstitutionen als soziale Homogenisierungsinstrumente eingesetzt, die zur "Gleichschaltung der unterschiedlichen individuellen Formen der Informationsverarbeitung"27 dienen. Und drittens erscheint Kultur dabei als ein Regelsystem, das nicht nur in sich selbst homogen ist, sondern sich darüber hinaus auf einen homogenen Gegenstandsbereich bezieht: nämlich auf die symbolische Ordnung von Normen, Werten, Bedeutungen, Überzeugungen, Handlungsroutinen, Praktiken usw.
Dieses grundlegende Kulturverständnis, das sich zusammen mit der typographisch geprägten Industriegesellschaft ausgebreitet hat, ist auch von denjenigen Kommunikationstheorien nicht in Frage gestellt worden, die sich implizit oder explizit an elektronischen oder digitalen Leitmedien orientieren. Das kommt allein schon in dem Sachverhalt zum Ausdruck, dass die implizite oder explizite Orientierung an einem Leitmedium beibehalten worden ist. Das gilt nicht nur – wie bereits gezeigt – für Shannon und Weaver oder Luhmann, sondern auch für die geschichtsphilosophischen Konstruktionen eines medialen Epochenwechsels, die sich bei McLuhan,28 Meyrowitz,29 Postman30 oder Bolz31 finden.
Das leitmedienorientierte Entweder-Oder-Denken schreibt eine kulturtheoretische Standardisierungsvorstellung fort, derzufolge (als homogene Komplexe konzipierte) Kulturen das Produkt von einheitlichen Kommunikationsgewohnheiten sind, die durch bestimmte Leitmedien ermöglicht oder sogar determiniert werden. Die reduktionistische Zuspitzung dieser Sichtweise hat zu Medientheorien geführt, die den Bereich des Kulturellen nicht mehr in Abgrenzung vom Technischen, sondern wie Kittler und viele seiner SchülerInnen als dieses selbst definieren. Die als technisch prozessierende und technisch zu beschreibende Hardware bestimmte Kultur wird auf diesem Weg nur auf eine materiell anders bestimmte Form von Homogenität festgelegt.32
Demgegenüber hat Giesecke die Entwicklung eines neuartigen Kulturkonzepts vorgeschlagen, das Kultur als "inhomogenes Netzwerk artverschiedener Elemente"33 versteht. Die als Kultur zu bestimmende Vernetzung von sozialen, technischen und natürlichen Gegenständen wird von ihm im Rahmen seines "Projekts einer ökologischen Theorie und Geschichte kultureller Kommunikation"34 untersucht. Dabei verweist das Epitheton "ökologisch" auf Gieseckes Versuch, den Kommunikationsbegriff von der impliziten oder expliziten Prämierung bestimmter Einzelmedien zu emanzipieren und eine Kommunikationstheorie zu begründen, die Kommunikation als multidimensionales, sowohl medienspezifisches als auch medienübergreifendes Phänomen beschreibbar macht. Zu diesem Zweck greift Giesecke auf eine informationstheoretische Metatheorie zurück, die Kommunikation als Parallelverarbeitung von Information beschreibt.
Im Unterschied zu Shannon/Weaver, Luhmann oder Kittler jedoch nutzt Giesecke die informationstheoretische Terminologie nicht, um der Kulturwissenschaft das Image einer mehr oder weniger "harten" Disziplin zu verschaffen. Statt dessen wird die technische Terminologie von ihm derart erweitert und flexibilisiert, dass sie im Rahmen eines heterogenen "Konzeptnetzwerk[s]"35 die multiperspektivische Rekonstruktion ihrer eigenen Grundlagen leistet. Dazu gehört auch, dass die solchermaßen projektierte "kulturelle Informatik"36 an die Perspektive des historisch situierten Menschen und seiner kontingenten Interessenlagen zurückgebunden wird. An die Stelle der systemtheoretischen Beobachterposition, welche den Menschen (ohne Rekurs auf göttliche Instanzen) zu transzendieren versucht, tritt bei Giesecke eine kulturtherapeutische Beraterperspektive. Sie versucht den Anthropozentrismus weder zu begründen noch zu transzendieren, sondern mit ihm experimentell und pragmatisch zu arbeiten.37
Als Komplement zu Gieseckes kulturwissenschaftlicher Flexibilisierung der Informationstheorie bietet sich eine nicht nur in ihrem Ausgangspunkt, sondern auch in ihrer Durchführung stärker pragmatisch ausgerichtete corporate identity der zeitgenössischen Kulturwissenschaften an. Das freilich würde voraussetzen, dass die Fundierungsverhältnisse zwischen Medien, Kommunikation und Kultur nicht nur deskriptiv und informationstheoretisch, sondern auch politisch und pragmatisch ausbuchstabiert werden. Angesichts einer Diskurslage, in der viele Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler sich angewöhnt haben, vor Moral eher zu warnen als sich an ihr zu orientieren,38 kann ein Rückblick auf die Begriffsgeschichte des Ausdrucks Geisteswissenschaft hilfreich sein.
In seinem Beitrag zur eingangs zitierten Denkschrift hat Jürgen Mittelstraß darauf hingewiesen, dass der "Ausdruck Geisteswissenschaft [...] seine institutionelle und universitäre Bedeutung [...] über ein terminologisches Missverständnis"39 gewonnen hat. In der 1849 erschienenen deutschen Übersetzung von John Stuart Mills System of Logic (1843) ist der wissenschaftssystematische Ausdruck moral science nicht gerade treffend mit dem Wort Geisteswissenschaft wiedergegeben worden. Auf diesem Weg sind die moralischen Wissenschaften, zu denen bei Mill nicht nur Ethik, Politik, Ökonomik, die Künste und Techniken, Jurisprudenz und Teile der Theologie gehörten, sondern auch Psychologie, Ethologie und Soziologie, im Fortgang der modernen Wissenschaftsgeschichte "unter eine fremde, nämlich eine 'idealistische' Systematik"40 geraten. Dieser Sachverhalt hat dazu beigetragen, dass die heute als sozialwissenschaftlich einzuordnenden Disziplinen sich von den Geisteswissenschaften abgespalten und stärker an positivistischen Wissenschaftsidealen zu orientieren begonnen haben.
Die sich gegenwärtig vollziehende "Renaissance des Pragmatismus"41 lässt den Hinweis von Mittelstraß in neuem Licht erscheinen. Die Rückbesinnung auf das soziopolitisch und handlungsorientiert ausgerichtete Wissenschaftsverständnis der von Mill anvisierten moral sciences könnte in der aktuellen Diskussion eine fächerkulturenübergreifende Horizontfunktion erfüllen. Damit ließe sich das Anliegen verbinden, Gieseckes kommunikationstheoretische Strategie einer natur- und techniksensiblen Transformation des kulturalistisch gewendeten Geistes der Geisteswissenschaften um eine zusätzliche Dimension zu erweitern. Die wissenschaftstheoretisch reflektierte Orientierung am gemeinsamen Ziel einer ökologischen Optimierung und mediengestützten Globalisierung demokratischer Kommunikationsverhältnisse würde dabei als ein wichtiges Verbindungsglied fungieren; und zwar nicht nur zwischen den verschiedenen kulturwissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch zwischen Kultur- und Sozialwissenschaften und darüber hinaus zwischen den human-, technik- und naturwissenschaftlichen Fächerkulturen insgesamt.42
In diesem Rahmen käme den Kulturwissenschaften eine besondere wissenschaftspolitische Verantwortung zu. Sie bestünde darin, die Art und Weise, wie sich mithilfe von Medien Kommunikationsverhältnisse gestalten lassen, nicht nur deskriptiv, abstrakt und scheinbar neutral zu untersuchen, sondern zugleich auch darauf hin zu befragen, wie die verschiedenen Medien genutzt werden können, um ganz bestimmte, nämlich demokratisch geprägte Kommunikationsverhältnisse sowohl ökologisch zu optimieren als auch für weltweit vernetzte Formen der Mensch-Mensch-, Mensch-Maschine- und Mensch-Natur-Interaktion zu sensibilisieren. Würde sich die zeitgenössische Kulturwissenschaft dieser Verantwortung in Zukunft noch stärker und gezielter stellen, wäre damit zugleich eine Art wissenschaftskulturelles Auffangnetz geschaffen. Denn angesichts des komplexen Ausdifferenzierungsgrades, der für die modernen Universitätsbürokratien charakteristisch ist, darf es als unwahrscheinlich gelten, dass sich ein transdisziplinär konzipiertes Vokabular (wie das von Giesecke vorgeschlagene) in absehbarer Zeit wissenschaftskulturenübergreifend etablieren lässt.
Literatur
Böhme, Hartmut / Matussek, Peter / Müller, Lothar (2000), Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will, Reinbek: Rowohlt.
Bolz, Norbert (1993), Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse, München: Fink.
Campe, Joachim H. (1813), Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke, Braunschweig: Schulbuchhandlung.
Carstensen, Broder / Busse, Ulrich (1994), "Massenmedien" und "Medium", in: Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945, Berlin: de Gruyter, S. 884f. und S. 892f.
Faßler, Manfred (2001), Netzwerke, München: Fink.
Frühwald, Wolfgang / Jauß, Hans Robert / Koselleck, Reinhart / Mittelstraß, Jürgen / Steinwachs, Burkhart (1991), Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Giesecke, Michael (1991), Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Giesecke, Michael (1992), Sinnenwandel-Sprachwandel-Kulturwandel. Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Giesecke, Michael (2002), Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft. Trendforschungen zur kulturellen Medienökologie (Mit einer CD-ROM mit dem Volltext des Buches sowie weiteren Aufsätzen und Materialien), Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Hoffmann, Stefan (2002), Geschichte des Medienbegriffs, Hamburg: Meiner.
Kittler, Friedrich (1993), Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig: Reclam.
Kittler, Friedrich (2000), Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, München: Fink.
Kittler, Friedrich (2002), Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin: Merve.
Krallmann, Dieter / Ziemann, Andreas (2001), Grundkurs Kommunikationswissenschaft, Paderborn: Fink.
Luhmann, Niklas (1984), Soziale Systeme, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Margreiter, Reinhard (2003), "Medien/Philosophie: Ein Kippbild", in Münker, Stefan / Roesler, Alexander / Sandbothe, Mike (Hg.), Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs, Frankfurt/M.: Fischer, S. 150-171.
McLuhan, Marshall (1968), Die magischen Kanäle. Understanding Media, Düsseldorf/Wien: Econ (im Original zuerst: Understanding Media. The Extensions of Man, London/New York: McGraw-Hill 1964).
Merten, Klaus (1999), Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Bd 1: Grundlagen der Kommunikationswissenschaft, Münster: Lit-Verlag.
Meyrowitz, Josuha (1990): Die Fernseh-Gesellschaft, 2 Bde, Weinheim/Basel: Beltz (im Original zuerst: No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behaviour, Oxford/New York: Oxford University Press 1985).
Münker, Stefan / Roesler, Alexander / Sandbothe, Mike (Hg.) (2003), Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs, Frankfurt/M.: Fischer.
Nowotny, Helga (1999), Es ist so. Es könnte auch anders sein. Über das veränderte Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Postman, Neil (1985), Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie, Frankfurt/M.: Fischer (im Original zuerst: Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, New York: Viking-Penguin).
Reckwitz, Andreas (2000), Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Sandbothe, Mike (2000) (Hg.), Die Renaissance des Pragmatismus. Aktuelle Verflechtungen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Sandbothe, Mike (2001), Pragmatische Medienphilosophie. Grundlegung einer neuen Disziplin im Zeitalter des Internet, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Sandbothe, Mike / Nagl, Ludwig (Hg.) (2003), Systematische Medienphilosophie, Berlin: Akademie-Verlag.
Saussure, Ferdinand de (1967), Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin: de Gruyter (im Original zuerst: Cours de linguistique générale, Paris: Payot 1916).
Schmidt, Siegfried J. / Zurstiege, Guido (2000), Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, was sie will, Reinbek: Rowohlt.
Steiner, Uwe C. (1997), "'Können die Kulturwissenschaften eine neue moralische Funktion beanspruchen?' Eine Bestandsaufnahme", in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft, 1, S. 5-38.
Stetter, Christian (1997), Schrift und Sprache, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Ungeheuer, Gerold (1982), "Vor-Urteile über Sprechen, Mitteilen, Verstehen", in: Ungeheuer, Gerold, Kommunikationstheoretische Schriften I: Sprechen, Mitteilen, Verstehen, Aachen: Rader, S. 290-338.
Vogel, Matthias (2001), Medien der Vernunft. Eine Theorie des Geistes und der Rationalität auf Grundlage einer Theorie der Medien, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Weingart, Peter (2001), Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der Wissensgesellschaft, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Welsch, Wolfgang (1999), "Auf dem Weg zu transkulturellen Gesellschaften", in: Seubold, Günter (Hg.), Die Zukunft des Menschen. Philosophische Ausblicke, Bonn: Bouvier, S. 119-144.
Wittgenstein, Ludwig (1988), Philosophische Untersuchungen, in: Wittgenstein, Ludwig, Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
1 Frühwald u.a. (1991). Zum aktuellen Stand der Diskussion vgl. auch Böhme u.a. (2000).
2 Schmidt/Zurstiege (2000).
3 Vgl. hierzu die Beiträge von Krämer, Seel und Vogel in: Münker u.a. (2003), sowie Vogel (2001).
4 Wittgenstein (1988, S. 278 [§67]).
5 Für einen ähnlichen Ansatz siehe Margreiter (2003, insbes. S. 151ff.).
6 Ich danke Erik Porath für den Hinweis, dass die von mir in früheren Publikationen verwendete Rede von "technischen Verbreitungsmedien" missverständlich, weil funktional zu eng bestimmt ist. Der Vorschlag, statt dessen den komplexeren Terminus "Verbreitungs-, Verarbeitungs- und Speichermedien" zu verwenden, geht auf ihn zurück. Wenn im folgenden gleichwohl an einzelnen Stellen von "Verbreitungsmedien" die Rede ist, ist das als abkürzende Redeweise zu verstehen.
7 Zur systematischen Durchführung dieses intermedialitätstheoretischen Forschungsprogramms vgl. Sandbothe/Nagl (2003).
8 Hoffmann (2002, insbes. S. 24-28).
9 Hoffmann beschreibt diesen Übergang als eine "Prototypenverschiebung" (Hoffmann, 2002, S. 28). Vgl. hierzu auch Campe (1813), auf den sich Hoffmann stützt.
10 Vgl. hierzu die Artikel 'Massenmedien' und 'Medium' in: Carstensen/Busse (1994).
11 Giesecke (1991); Giesecke (1992).
12 Saussure (1967).
13 Giesecke (1992 S. 31).
14 Giesecke (1992, S. 50f.).
15 Vgl. hierzu auch die sprach- und schriftphilosophischen Untersuchungen von Stetter (1997), die allerdings mit einem Schriftbegriff arbeiten, der die technischen Differenzen von Skripto- und Typographie nicht ausreichend berücksichtigt.
16 Ungeheuer (1982, S. 295).
17 Zur kommunikationswissenschaftlichen Rezeptionsgeschichte des Shannon-Weaver-Modells vgl. Merten (1999, S. 74ff.), sowie Krallmann/Ziemann (2001, S. 31ff.).
18 Luhmann (1984, S. 193).
19 Luhmann (1984, S. 194).
20 Faßler (2001, S. 160f.).
21 Grassmuck, zitiert nach Faßler (2001, S. 239).
22 Sandbothe (2001, Kapitel IV bis VI).
23 Reckwitz (2000, insbes. S. 64-90).
24 Reckwitz (2000, S. 543).
25 Welsch (1999, insbes. S. 122-126).
26 Giesecke (2002, S. 206). Vgl. hierzu auch Gieseckes Liste der "elf Mythen der Buchkultur" (ebd., S. 223ff.).
27 Giesecke (2002, S. 238).
28 McLuhan (1968).
29 Meyrowitz (1990).
30 Postman (1988).
31 Bolz (1993).
32 Kittler (1993); Kittler (2002). Die damit verbundene Exklusion des Sozialen bleibt für Kittler verbindlich, obwohl er selbst zu bedenken gibt, dass er sie "womöglich aus idiosynkratischer Aversion" (Kittler, 2000, S. 17) vollzieht. Immerhin unterscheidet er sich durch dieses Bewusstsein von den meisten seiner SchülerInnen.
33 Giesecke (2002, S. 372).
34 Giesecke (2002, S. 10).
35 Giesecke (2002, S. 20).
36 Giesecke (2002, S. 17).
37 Vgl. hierzu Giesecke (2002, S. 32): "Der natürliche Ausgangspunkt für den Menschen ist dieser selbst. [...]. In diesem Sinn ist Anthropozentrismus in den Kulturwissenschaften unvermeidbar."
38 Steiner (1997).
39 Frühwald u.a. (1991, S. 26).
40 Frühwald u.a. (1991, S. 27).
41 Sandbothe (2000).
42 Vgl. hierzu auch Nowotny (1999) und Weingart (2001).