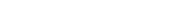erschienen in: Grenzverläufe. Der Körper als Schnittstelle, hrsg. von Annette Barkhaus und Anne Fleig, München: Fink 2002, S. 153-166.
Mike Sandbothe
Ist alles nur Text?
Bemerkungen zur pragmatischen Dekonstruktion menschlicher Körpererfahrung
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein Konzeptpapier, das der von Annette Barkhaus und Anne Fleig konzipierten Tagung Grenzverläufe. Der Körper als Schnittstelle zugrunde lag. Die Grundthese des Papiers besteht in der Annahme, daß sich gegenwärtig ein „Paradigmenwechsel“ vollziehe, in dessen Rahmen „fundamentale Orientierungen unserer Kultur (...) sich verflüssigen.“1 Dabei gehe es im wesentlichen um die Verflüchtigung der folgenden „Grenzziehungen“: „Hier und Dort, Mensch und Maschine, Realität und Virtualität, Tod und Leben.“2 Durch die fortschreitende Aufhebung dieser Differenzen, so weiter Barkhaus/Fleig, werde der menschliche Körper in doppelter Hinsicht zur „Schnittstelle“: zum einen im Bereich der Biomedizin als der „prothetisch erweiterte Körper“, zum anderen im Bereich der Neuen Medien als der „mit menschlichen Zügen versehene Computer (‚interface‘).“3
Im Fortgang des Konzeptpapiers wird die These, daß der Körper in Biomedizin und Neuen Medien als Schnittstelle fungiere, darüber hinaus in Zusammenhang gebracht mit einer sich im Bereich der Theorie vollziehenden „Anstrengung, die Materialität des Körpers als Effekt von Diskursen hinter einem umfassenden Textmodell verschwinden zu lassen.“4 Vor dem Hintergrund der doppelten - einerseits biomedizinisch-medientechnologischen, andererseits texttheoretisch-dekonstruktivistischen - Tendenz zur „Entkörperung“ geht es den beiden Autorinnen darum, „die unterschiedlichen Felder: Dekonstruktion, Biomedizin und Neue Medien (...) erstmals in einem Diskurs miteinander“ zu verschränken. Ziel dieser Verschränkung sei es, „eine neue Theoriebildung zu initiieren“ und „der in ihrer Ambivalenz verharrenden Zeitdiagnose (...) die Anstrengung des Begriffs“ entgegenzustellen. Die „Hauptfrage“ richte sich dabei auf das Problem, ob mit der sich abzeichnenden „neuen Konzeptualisierung des Körpers“ ein „Wechsel vom Humanismus zum Posthumanismus“ verbunden ist.
Meine Ausführungen bestehen aus drei Bemerkungen, die sich mit den von Barkhaus/Fleig exponierten Arbeitshypothesen auseinandersetzen. Meine erste Bemerkung bezieht sich auf die These, daß der Dekonstruktivismus auf der Ebene der Theorie eine analoge Entkörperungsbewegung vollziehe, wie sie sich im Bereich der Technologien abzeichne. Gegen diese These möchte ich den Begründer des philosophischen Dekonstruktivismus, Jacques Derrida, ein Stück weit verteidigen. In meiner zweiten Bemerkung werde ich dann aus der Perspektive des Pragmatismus eine Grundvoraussetzung problematisieren, die Derridas Denken mit den von Barkhaus/Fleig im Gegenzug gegen den Dekonstruktivismus ins Spiel gebrachten Philosophien des Leibapriori (Peter Sloterdijk5, Richard Shusterman6, Gernot Böhme7, Elisabeth List8 u.a.) teilt.9 Abschließend wird es dann in meiner dritten Bemerkung darum gehen zu zeigen, welche Konsequenzen sich aus den beiden ersten Bemerkungen für die Frage danach ergeben, wie die medialen Veränderungen, die für unsere Körpererfahrung im Internet charakteristisch sind, mit Veränderungen zusammenhängen, die unsere Körpererfahrung außerhalb des Netzes betreffen. Ähnlich wie bereits mit Blick auf Derrida werde ich auch mit Blick auf das neue Medium Internet die Entkörperungsdiagnose ein Stück weit problematisieren. Zu diesem Zweck werde ich mich mit Überlegungen auseinandersetzen, die Sybille Krämer in ihrem Beitrag zum vorliegenden Band entwickelt hat.
I.
Ausgangspunkt meiner ersten Bemerkung ist der Vorschlag, deutlich und präzise zwischen Derridas anspruchsvollem Dekonstruktivismus und den eher diffusen Populardekonstruktivismen zu unterscheiden, die von Barkhaus/Fleig zurecht kritisiert werden. Die pauschale Rede von der Auflösung der Materialität des Körpers in eine arbiträre Zeichenhaftigkeit allumfassender Textualität ist ein im Populardekonstruktivismus weit verbreiteter Effekt mangelnder Derrida-Lektüre. Das Konzept einer umfassenden Textualität, das Derrida sowohl von vielen Kritikerinnen und Kritikern als auch von einigen Schülerinnen und Schülern unterstellt wird, findet sich in dieser Form in seinem Denken nicht. Die Grundthese von Derridas frühem Hauptwerk De la grammatologie (1967) besagt vielmehr, daß es sich bei der an der schriftlichen Textualität ablesbaren Verweisungsstruktur der différance um eine semiotische Grundstruktur der Erzeugung von Sinn handelt, die auf unterschiedlich ausgeprägte Art und Weise sowohl unseren raumzeitlichen Wahrnehmungsmedien als auch unseren semiotischen Kommunikationsmedien zugrunde liegt. Die Grammatologie entwickelt keine umfassende Theorie der phonetischen Schrift oder der literalen Textualität. In ihr geht es vielmehr um eine Semiotik der Differenz, die darauf zielt, Raum, Zeit, Bild, Sprache, Schrift, aber auch Geste, Berühung, Bewegung, Geschmack und Geruch als durch die Bewegung der différance eng miteinander verflochtene Medien der Sinnkonstitution zu analysieren.
Daraus ergibt sich der im vorliegenden Zusammenhang entscheidende Punkt. Das Denken der différance zielt bei Derrida nicht auf die Abschaffung des Körpers, sondern legt vielmehr die philosophischen Grundlagen frei, auf deren Basis wir sinnvoll und legitim vom Körper als einer nichtzeichenhaften, materialen Entität sprechen können. Als Mechanismus der Erzeugung von Sinn hat die différance zwei Grundbestimmungen. Die erste Grundbestimmung besteht darin, daß Sinn und Bedeutung aus dem Verweis von Zeichen auf Zeichen hervorgehen. Die zweite Grundbestimmung besagt, daß es zugleich ein struktureller Effekt der différance ist, daß Zeichen als Entitäten erscheinen, die nicht auf Zeichen, sondern auf nichtzeichenhafte Referenten verweisen.10 Übertragen auf unsere Rede vom menschlichen Körper bedeutet das, daß wir darin zwei Sachverhalte zu unterscheiden und im Unterscheiden zugleich zusammenzudenken haben. Der eine Sachverhalt besteht darin, daß wir uns, wenn wir von unserem Körper reden, der Intention nach auf unseren Körper als auf etwas Nichtzeichenhaftes beziehen. Der zweite Sachverhalt besagt, daß wir, wenn wir über unsere Rede vom Körper als einer Rede, die sich auf etwas Nichtzeichenhaftes bezieht, zu reflektieren beginnen, zugleich feststellen, daß wir etwas als Nichtzeichenhaftes und Vorinterpretatives nur verstehen können, weil wir die Verwendung des Zeichens ‚das Nichtzeichenhafte‘ beherrschen, d.h. die Deutung von etwas als ‚deutungsunabhängig‘ vollziehen können.
Hat man diese innere Dialektik einmal begriffen, die Derrida in seiner Dekonstruktion des Zeichenbegriffs freilegt, wird klar, daß daraus keineswegs folgt, daß unsere Rede vom Körper als etwas Nichtzeichenhaftem oder Vorinterpretativem philosophisch illegitim wäre. Im Gegenteil. Derridas Dekonstruktion des Körperbegriffs besagt, daß unsere Rede vom Körper als einer interpretationstranszendenten Entität philosophisch genau dann gerechtfertigt ist, wenn wir sie als Effekt der différance verstehen. Das heißt: die Rede vom Körper als einer vorinterpretativen Entität ist so zu verstehen, daß wir zwar keine unmittelbare Gewißheit von unserem Körper als einer nichtzeichenhaften Entität haben, wir uns aber innerhalb unserer Interpretationen durchaus zurecht derart auf unseren Körper beziehen, daß wir diesen als interpretationstranszendent auffassen.11
Vor dem Hintergrund dieser Dialektik sind aus der Perspektive Derridas die popular-dekonstruktivistischen Slogans „Alles ist Text“ oder „Alles besteht aus Zeichen“ als in sich selbst widersprüchlich zu kritisieren. Denn die différance als diejenige semiotische Struktur, die der Konstitution von Sinn zugrunde liegt, ist aus Derridas Sicht gerade so verfaßt, daß Texte als Texte und Zeichen als Zeichen über sich hinaus auf Transtextuelles bzw. Nichtzeichenhaftes verweisen. Der Witz der Dekonstruktion besteht nicht darin, diesen Schein zu zerstören und an seine Stelle die vermeintliche Wahrheit zu setzen, daß in Wirklichkeit alles bloß Text bzw. Zeichen sei. Der Dekonstruktion geht es vielmehr darum, diesen Schein als Schein in seinem Eigenrecht verständlich zu machen und anzuerkennen. Dieses Eigenrecht läßt sich durch den folgenden Zusammenhang verdeutlichen: Indem unser Umgang mit Zeichen der Intention nach auf die Bezeichnung eines Nichtzeichenhaften zielt, wird er zum Motor einer unendlichen Zeichenproduktion, in der das Nichtzeichenhafte als Telos sowohl intendiert als auch immer wieder aufgeschoben und verfehlt wird. Im Rückbezug auf die Körperthematik bedeutet das, daß unsere Rede vom Körper auch und gerade nach Derrida auf eine nichtzeichenhafte, transtextuelle Entität zielt, die jedoch im Prozeß ihrer Signifikation nur im Modus des unendlichen Aufschubs, d.h. im Vollzug ihrer prinzipiellen Undarstellbarkeit thematisch zu werden vermag.
Eben dieser für Derridas Denken entscheidende Aspekt der Undarstellbarkeit und des Aufschubs wird von den oben genannten Verfechtern eines philosophischen Leibapriori systematisch ausgeblendet. Wer den Körper zum Fundament unserer Welterschließung erklärt und als unmittelbar zu erfahrende Basis unserer welterzeugenden Gewißheit reklamiert, argumentiert auf der Grundlage eines umgekehrten Cartesianismus. Während Descartes das fundamentum inconcussum im cogito als Instanz basaler Selbsvergewisserung festzumachen versuchte, gehen die Verfechter einer authentischen Körpererfahrung davon aus, daß wir in einer ursprünglichen Nähe zu unserem Körper existieren, die dem Prozeß der Signifikation als dessen quasi-transzendentale Möglichkeitsbedingung vorangeht. Aus der Perspektive Derridas kommt der menschlichen Körpererfahrung epistemologisch keine derartige Auszeichnung zu. Das Bild, das wir uns von unserem Körper auf der Grundlage visueller, motorischer, taktiler, olfaktorischer und emotionaler Erfahrung machen, ist nicht anders als das Bild, das wir uns von äußeren Gegenständen in der Welt machen, ein Bild, das auf etwas Deutungsunabhängiges zielt und, indem es das tut, bereits in den Prozeß einer unendlichen Signifikation involviert ist, der es verhindert, daß wir uns aufgrund unserer Leiblichkeit in einem authentischen Sinn mit uns selbst als Entität vor aller Interpretation kurzschalten könnten.
II.
Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf die pragmatische Wende, welche die moderne Philosophie in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat.12 Vor dem Hintergrund dieser Wende werde ich einen Vorschlag machen, wie sich Derrida auf pragmatische Weise reinterpretieren läßt. Da in Sachen Pragmatismus viele Mißverständnisse kursieren, möchte ich zunächst erläutern, wie sich die Grundhaltung eines pragmatischen Philosophieverständnisses von der theoretizistischen Perspektive unterscheidet, die den akademischen Diskurs über weite Strecken dominiert. Aus pragmatischer Perspektive gibt es zwei genuin theoretizistische Grundvoraussetzungen, die Derrida und die Verfechter des Leibapriori bei allen bestehenden Differenzen gleichwohl miteinander teilen. Erstens: Beide Schulen begreifen Philosophie als das theoretische Fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit von Sinnkonstitution und nach den Grundbestimmungen von Wirklichkeit. Zweitens: Beide Schulen versuchen, diese Grundfragen der theoretizistischen Philosophietradition mit medienphilosophischen Mitteln zu beantworten und entwickeln zu diesem Zweck auf jeweils unterschiedliche Weise theoretizistische Konzepte von Medienphilosophie.13
Im Unterschied zu ihren erkenntnis-, wissenschafts- und sprachphilosophischen Vorläuferdisziplinen rekurriert die theoretizistische Medienphilosophie zur Beantwortung der Frage nach den Möglichkeitsbedingungen von Sinn nicht allein auf transzendentalphilosophische, wissensmethodische, formallogische oder grammatische Regelsysteme, sondern darüber hinaus auf die diesen ex hypothesi zugrundeliegenden medialen und materialen Rahmenbedingungen. Im Fall der Leibphilosophie sollen diese Rahmenbedingungen in der Körperfundiertheit unserer Denkens bestehen und zwar derart, daß der Körper als dasjenige Medium ausgezeichnet wird, das unseren Weisen der semiotischen Welterzeugung zugrunde liegt.14 Anders und doch zugleich ähnlich Derrida. Für ihn gibt es zwar kein irgendwie ausgezeichnetes Fundamentalmedium, auf dessen unmittelbare Gewißheit wir zurückgreifen können. Aber in den transmedialen Verflechtungsverhältnissen, die seiner Perspektive zufolge zwischen den unterschiedlichen Medientypen bestehen, vollzieht sich für Derrida der als Grundstruktur von Medialität überhaupt zu begreifende Sinnerzeugungsmechanismus der différance.
Als ‚theoretizistisch‘ bezeichne ich den gesamten Problemzusammenhang, weil darin von allen konkreten Interessenzusammenhängen und allen bestimmten Zielsetzungen menschlicher Gemeinschaften abstrahiert wird. Die theoretizistische Ausbuchstabierung von Medienphilosophie, die sich auf unterschiedliche Weise bei Derrida und bei den Verfechtern eines epistemologisch ausgezeichneten Körpermediums findet, zielt auf die Möglichkeitsbedingungen unseres Selbst- und Weltverständnisses insgesamt und damit auf einen Bereich, der hinter dem Rücken aller praktischen Nützlichkeitshorizonte liegen und diese selbst erst hervorbringen, begründen oder legitimieren soll. Im Unterschied zur theoretizistischen setzt die pragmatische Aufgabenbestimmung der Medienphilosophie, die ich im folgenden im Rekurs auf den Vordenker des amerikanischen Neopragmatismus, Richard Rorty, skizziere, inmitten von kulturell und historisch vorgegebenen praktischen Interessenzusammenhängen und soziopolitischen Zielsetzungen an.
Rorty plädiert für einen Werkzeugbegriff des Mediums. Dabei werden Medien jedoch nicht – wie in der von Derrida kritisierten phonozentrischen Tradition – auf Werkzeuge zur sinnerhaltenden Übertragung von präexistenten Informationen reduziert. Statt dessen wird die Funktionsbestimmung des Mediums über den engen und für den Theoretizismus spezifischen Bereich der Bedingungen der Möglichkeit von Wirklichkeitserkenntnis hinaus auf den weiten Bereich menschlichen Handelns ausgedehnt. Menschliches Handeln wird von Rorty praktisch-politisch von den Gütern und Hoffnungen her verstanden, nach denen die Menschen in den westlichen Demokratien in den letzten zwei Jahrhunderten ihr öffentliches Verhalten – trotz aller Rückfälle – zunehmend auszurichten gelernt haben. Bei diesen Gütern und Hoffnungen handelt es sich um die für das politische Projekt der Aufklärung charakteristischen humanistischen Ideale der Vermehrung von Solidarität und der Verminderung von Grausamkeit und Demütigung im Zusammenleben der Menschen.15
Vor diesem Hintergrund ist auch Rortys Rede vom „Vorrang der Demokratie vor der Philosophie“16 zu sehen. Nach Rortys Ansicht sollten philosophische Debatten wie die um die beiden dialektisch zusammenzudenkenden Aspekte der différance auf die Frage zurückgebunden werden, welchen Nutzen sie für das politische Projekt einer weiter fortschreitenden Optimierung und Ausbreitung demokratischer Lebensformen haben. Was die von Barkhaus/Fleig akzentuierte Leitfrage nach dem Paradigmenwechsel vom Humanismus zum Posthumanismus angeht, ergibt sich aus dieser Perspektivierung eine spezifisch pragmatische Antwort. Sie lautet, daß das politische Projekt der Aufklärung von den philosophischen Theorien, die im Zeitalter der Aufklärung mit Blick auf das Wesen des Menschen entstanden sind, eher behindert als gefördert wird. Der von Derrida nahegelegte posthumanistische Verzicht auf die philosophische Reklamation einer letzten (bewußtseins- oder leibphilosophisch auszubuchstabierenden) Autorität, die im Wesen des Menschen festzumachen wäre, läßt sich Rorty zufolge mit einem Festhalten am politischen Humanismus nicht nur ohne weiteres verbinden, sondern wird von einem konsequenten politischen Humanismus geradezu gefordert.
Rortys Strategie, den demokratischen Anti-Autoritarismus der politischen Aufklärung gegen das philosophische Autoritätsdenken auszuspielen, das sich bis in die körperphilosophischen Autoritätsreklamationen einer großen Vernunft des Leibes (Nietzsche) fortschreibt, liegt den abschließenden Überlegungen zur aufklärerischen Bedeutung der pragmatischen Dekonstruktion unserer Körpererfahrung zugrunde, die sich im Internet vollzieht. Sie stehen im Zentrum meiner dritten und letzten Bemerkung.
III.
Diese Bemerkung möchte ich in Gestalt einer These formulieren. Sie besagt erstens, daß das Internet keinesfalls von sich aus - wie häufig mit mediendeterministischem Unterton zu hören ist - zu einer Nivellierung unserer Körpererfahrung oder gar zu einer tiefgreifenden „Entkörperung“ des Subjekts führt. Und sie besagt zweitens, daß sich mit der Nutzung des Internet im Bereich der interaktiven Kommunikationsdienste (Chat, MUDs und MOOs), auf die sich meine Ausführungen konzentrieren, eine pragmatische Dekonstruktion unseres Körperbewußtseins in Verbindung bringen läßt, die das Spektrum menschlicher Körpererfahrungen nicht verengt, sondern vielmehr erweitert. Daß die Kommunikationsformen, die sich in den schriftbasierten Chats und in den virtuellen Kommunikationslandschaften der MUDs und MOOs entwickeln, die Möglichkeit zu einer experimentellen Veränderung der korporalen Grundlagen unseres alltäglichen Wirklichkeitsverständnisses bietet, möchte ich auf dem Weg einer pragmatischen Reinterpretation von Derridas Medienphilosophie vor Augen führen.
Unter den medialen Rahmenbedingungen der Gutenberg-Galaxis stand der realistische Aspekt der différance im Vordergrund, demzufolge unser Zeichengebrauch auf Nichtzeichenhaftes verweist und unser Wirklichkeitsverständnis in der vermeintlich unmittelbaren Gewißheit körperlicher Selbsterfahrung gründet, die dabei als Paradigma für die Unterscheidung des Nichtzeichenhaften vom Zeichenhaften dient. Im Zeitalter des Fernsehens wird demgegenüber der antirealistische Aspekt der différance akzentuiert. Diesem Aspekt zufolge erscheint die supponierte Gewißheit körperlicher Selbsterfahrung als Effekt eines komplexen semiotischen Verweisungsgefüges von Zeichen, deren Sinn sich holistisch durch den Bezug auf andere Zeichen konstituiert. In einer zunehmend durch das Internet geprägten Medienkultur schließlich könnte der Umgang mit den interaktiven Kommunikationsdiensten zu einer Rekonfiguration der Grundstukturen menschlicher Körperlichkeit führen, durch welche die epistemologische Opposition von Realismus und Antirealismus unterlaufen würde. Diese Rekonfiguration läßt sich als pragmatische Dekonstruktion unserer Körpererfahrung beschreiben. Was ist damit gemeint?
Ich beginne mit der virtuellen Körpererfahrung im Internet und gehe dann zur realen Körpererfahrung außerhalb des Netzes über. Zunächst erscheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, daß das eine (die virtuelle Köperlichkeit) das andere (den realen Körper) nicht ausschließt. Im Gegenteil. Die Existenz des realen Körpers außerhalb des Netzes ist die pragmatische Voraussetzung für die Konstruktion eines virtuellen Körpers im Netz – eine Konstruktion, wie sie exemplarisch in den virtuellen Kommunikationslandschaften der MUDs und MOOs geschieht, sobald man beginnt, seinen „character“ zu definieren. Der Sachverhalt, daß die Konstruktion eines virtuellen MUD-oder-MOO-Körpers die Existenz eines physischen Real-Life-Körpers nicht ausschließt, sondern im Regelfall vielmehr voraussetzt, ist derart banal, daß es eigentlich überflüssig sein sollte, ihn eigens zu erwähnen.
Die Notwendigkeit, auf diesen Sachverhalt hinzuweisen, ergibt sich aus Mißverständnissen, die sich aus dem Umfeld amüsanter Cybermythen in die ernsthafte medienphilosophische Diskussion hinein fortgeschrieben haben. Gegen ihre eigene Intention trägt auch Sybille Krämer in ihrem Beitrag zum vorliegenden Band zur medienphilosophischen Nobilitierung dieser Mißverständnisse bei, wenn sie den Unterschied zwischen mündlicher und telematischer Kommunikation als „Unterschied zwischen einer körpergebundenen und einer körperentbundenen Form der Kommunikation“17 beschreibt. In ihren Überlegungen geht Krämer zunächst durchaus treffend von dem faktischen Phänomenbestand aus, daß im mündlichen face-to-face-Gespräch die Kommunikation als Kommunikation unter gleichzeitg (in einem lebensweltlich abgegrenzten Raum) Anwesenden stattfindet, während es sich bei der telematischen Chatkommunikation normalerweise um Kommunikation unter Kommunikationspartnern handelt, die nicht gleichzeitig (in einem lebensweltlich abgegrenzten Raum) anwesend sind. Daraus zieht Krämer jedoch den irritierenden Schluß, daß es sich bei der Internetkommunikation um eine „körperentbundene“ Form der Kommunikation handle. Das in dieser Rede von der Körperentbundenheit zum Ausdruck kommende Mißverständnispotential wird deutlich, wenn Krämer in ihrem Aufsatz die telematische Kommunikationsform in Abgrenzung von einer anderen Form der Kommunikation beschreibt, bei der die Kommunikationspartner ebenfalls normalerweise nicht gleichzeitig im selben Raum anwesend sind: dem Telefonieren.
Mit Blick auf die von ihr angenommene Körperentbundenheit telematischer Chatkommunikation schreibt Krämer: „Diese Entkörperung unterscheidet (...) die computergenerierte Kommunikation von einer anderen Art interaktiver Fernkommunikation, dem Telefonieren, bei dem die Stimme den Körper der Telefonierenden am Kommunikationsgeschehen beteiligt sein läßt.“18 Dem von Krämers Medientheorie unbelasteten Leser stellt sich hier die (nur scheinbar) naive Frage, was denn die körperliche Beteiligung unserer Stimmbänder beim Telefonieren von der körperlichen Beteiligung unserer in die Tastatur tippenden Fingerspitzen beim Chatten so fundamental unterscheiden soll? Offensichtlich handelt es sich dabei doch nur um unterschiedliche Teile des realen Körpers, die als pragmatische Möglichkeitsbedingung für die Kommunikation synchron miteinander interagierender Gesprächspartner fungieren.19 Die von Krämer reklamierte Opposition zwischen körpergebundener und körperentbundener Kommunikation überinterpretiert den faktischen Unterschied, der zwischen dem mündlichen face-to-face-Gespräch und der Chatkommunikation besteht, umwillen der von Krämer verfolgten symbolistischen Medientheorie.20 Genausowenig wie wir die Telefonkommunikation allein deshalb bereits als „körperentbunden“ interpretieren, weil sich die kommunizierenden Gesprächspartner nicht notwendig in einem Raum befinden, begreifen wir auch die Chatkommunikation im Internetalltag nicht, wie von Krämer aus theoriinternen Gründen suggeriert, als „Kommunikation zwischen Personen ohne Körper“.21
Im Gegenteil: Die schriftliche Interaktion in MUDs und MOOs wird von vielen Nutzerinnen und Nutzern sogar als ‚körperlicher‘ als die Telefon-Kommunikation empfunden. Einmal von Praktiken wie Telefonsex abgesehen, bei denen auch im Medium des Telefons Beschreibungen von realen oder imaginären Körpern mit ins Spiel kommen, substituiert der Klang der Stimme in der Telefonkommunikation im Regelfall die Präsenz des leiblichen Körpers, so daß sich eine explizite Thematisierung (oder aktive Konstruktion) des Körperbildes erübrigt. Anders in den MUDS und MOOs. Hier ist die Konstruktion eines virtuellen Körpers die Voraussetzung für die Teilnahme an der Kommunikation. Wer sich keinen „character“, keine „persona“ definiert, kann nicht an den Praktiken der interaktiven Kommunikationslandschaften partizipieren. Die aktive Auseinandersetzung mit dem Körper, die online in der Notwendigkeit zum Ausdruck kommt, sich einen virtuellen Körper zu entwerfen, verbindet sich in den MUDs und MOOs mit der Frage nach dem Verhältnis, in dem der virtuelle zum realen Körper steht. Eine Frage, die sich den Nutzerinnen und Nutzern im Internet sehr schnell stellt und zum Ausgangspunkt für produktive Irritationen, kreative Denkanstösse und dekonstruktive Transformationen werden kann, die sich auf unser alltägliches Körperverständnis und unseren gewohnten Körperumgang auswirken.
Um die pluralen Körperidentitäten, die wir im Internet entwickeln, sinnvoll zu unserer Offline-Existenz in Beziehung zu setzen, ist es wichtig, daß die virtuellen Aspekte im Realen und die realen Aspekte im Virtuellen durchschaut und anerkannt werden. Das Bild, das ich mir von meinem Körper mache, ist Teil meiner persönlichen Identität, die ihrerseits von meinen Zukunftsplänen getragen und von meiner Sicht auf meine Vergangenheit geprägt wird.22 Brechen meine Zukunftsprojekte zusammen, hat das Folgen für meine gegenwärtige Identität und für das mit ihr verbundene Körperbild. Beide kommen in Bewegung, werden virtuell, d.h. beginnen mit anderen möglichen Identitäten und imaginierten Körperbildern, die sich aus neuen Zukunftsentwürfen ergeben, zu konkurrieren. Und umgekehrt gilt: habe ich mich im Netz auf eine bestimmte Körperidentität festgelegt und begonnen, mich mit dieser zu identifzieren, dann bekommt sie ihre eigene Realitätsdimension. Wenn jemand dem virtuellen Körper der Person, die ich darstelle, Gewalt antut, dann fühle ich mich persönlich angegriffen oder verletzt. Und wenn ich meinerseits als diese Person dem virtuellen Körper einer anderen Person Gewalt antue oder mich einfach schlecht verhalte, dann empfinde ich Scham und Reue. Mit der virtuellen Körperidentität verbinden sich dann sehr reale Gefühle. Hat man die Übergängigkeit erst einmal durchschaut, die das Reale mit dem Virtuellen von innen her verbindet, dann stehen sich reale und virtuelle Körpererfahrung nicht mehr wie Sein und Schein, wie Ernst und Spiel, wie Wahrheit und Lüge gegenüber. Sie erscheinen dann vielmehr als zwei Weisen menschlicher Körperlichkeit, die sich auf sinnvolle Weise miteinander verflechten lassen und sich in erster Linie dadurch unterscheiden, daß sie in verschiedenen Medien stattfinden.
Die Erfahrung virtueller Körperlichkeit im Netz kann sogar dazu führen, daß wir die körperlichen Aspekte der face-to-face-Kommunikation erst wieder richtig schätzen lernen. Das Spiel der Gesten, der Reiz der kurzen Berührung, der Augenkontakt – das alles sind Dinge, die bei vielen Menschen längst routinisiert sind und deshalb nicht mehr bewußt erfahren werden. Die anästhetische Reduktion der Kommunikation, die für die digitalen Textwelten des Internet-Chat charakteristisch ist, kann dazu führen, daß wir nach einem Ausflug in die Welt der schriftbasierten Online-Interaktion die volle körperliche Präsenz des anderen in der realen Kommunikation auf neue und intensivere Weise wahrnehmen. Es findet eine Revalidierung, eine positive Neubewertung der face-to-face-Kommunikation statt.23 Wir lernen ihre Besonderheiten wieder schätzen und beginnen, sie sensibler einzusetzen. Auch unsere eigenen Gesten und Blicke werden uns bewußter, weil wir im Netz vorübergehend gezwungen waren, das, was wir sonst mit dem realen Körper unbewußt artikulieren, bewußt in Schriftsprache auszudrücken. Diese Bewußtheit läßt sich bewahren, wenn wir von den anästhetischen Körperwelten des Netzes in die synästhetischen Körperspiele der realen Welt zurückkehren.
So kann die Möglichkeit, im Internet einmal probeweise in die Rolle des anderen Geschlechts zu schlüpfen, für die reale Geschlechterrolle eine Menge in Bewegung bringen. Wer im Internet Erfahrungen mit ‚gender swapping‘ gesammelt hat, kann unter Umständen ein besseres Einfühlungsvermögen in die sexuelle Wahrnehmung seines Partners bzw. seiner Partnerin entwickeln.24 Auch die Notwendigkeit, sexuelle Erfahrung in Worte zu fassen, kann befreienden und kreativen Charakter haben. Der Raum des Sexuellen ist in der wirklichen Welt bei vielen Menschen immer noch ein Raum der Sprachlosigkeit und des Schweigens. Internetkontakte können dazu beitragen, das Sexuelle mit dem Sprachlichen zu verbinden. Daraus kann eine intelligentere und interessantere Sexualität hervorgehen. Das kann sein, muß aber nicht. Selbstverständlich sind auch Gegenszenarien möglich: Leute, die nur noch virtuell genießen können, aber mit realen Körpern und physischer Nähe nichts mehr anfangen können.
Wie sich der Umgang mit der virtuellen Körperlichkeit im Internet auf unseren Körperumgang außerhalb des Netzes auswirkt, läßt sich nicht mediendeterministisch deduzieren. Hier kommt vielmehr alles darauf an, ob und wie wir die Schnittstelle, die virtuelle und reale Körperlichkeit sowohl miteinander verbinden als auch voneinander trennen kann, pragmatisch nutzen lernen. Wir können diese Schnittstelle am Leitfaden einer realistischen Medienkultur als den Ort einer epistemologischen Dualität interpretieren, durch die „der Körper (...) aufgespalten [wird] in einen leiblichen, raum-zeitlich situierten physischen Körper und einen virtuellen, nur als Datenausdruck gegebenen Körper.“25 Wir können das Interface aber auch am Leitfaden einer antirealistischen Medienkultur dahingehend deuten, daß die Erfahrung der Zeichenhaftigkeit des Körpers im Internet, in dem ja in gewisser Weise tatsächlich alles nur Text ist, auch und gerade die realistisch supponierte Nichtzeichenhaftigkeit des Körpers außerhalb des Netzes mit in Frage stellt. Beide Lesarten sind einseitig, weil sie die innere Dialektik der différance ausblenden, die von Derrida und Butler herausgearbeitet worden ist. Zugleich aber handelt es sich dabei um Einseitigkeiten, die nicht nur in der Theorie existieren, sondern sich auch anhand unterschiedlicher Nutzungsformen konkretisieren lassen. Diese ergeben sich aus der (entweder mehr durch den Buchdruck oder mehr durch das Fernsehen geprägten) massenmedialen Sozialisation, auf deren Basis sich die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer das Internet aneignen.26
Um die erkenntnistheoretische Dualität von Realismus und Antirealismus und die mit ihr verbundenen Einseitigkeiten zu überwinden und damit über die weit verbreitete Tendenz hinauszukommen, das Internet am Leitfaden unseres eingeübten Umgangs mit den traditionellen Massenmedien zu interpretieren, könnte es für zeitgenössische Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlicher hilfreich sein, die dialektische Dekonstruktion des Körperbegriffs, die Derrida und Butler vollzogen haben, pragmatisch zu reinterpretieren und für die medienphilosophische Analyse unseres Umgangs mit dem Internet nutzbar zu machen. Einen Vorschlag in diese Richtung habe ich in den vorliegenden Ausführungen zu machen versucht. Dieser Vorschlag läuft auf den Versuch hinaus, die Dekonstruktion unserer Körpererfahrung, die sich im Internet vollzieht, in ihrer inneren Dialektik zu realisieren und auf dieser Basis pragmatisch zu wenden.
Die innere Dialektik der beschriebenen Dekonstruktion unserer Körpererfahrung besteht darin, daß uns die Erfahrung der Zeichenhaftigkeit virtueller Körperlichkeit im Netz auf die Erfahrung der Nichtzeichenhaftigkeit realer Körperlichkeit außerhalb des Netzes derart verweist, daß wir diese Nichtzeichenhaftigkeit selbst als Deutung zu verstehen und bewußt zu vollziehen lernen. Geschieht das, kann sich daraus eine pragmatische Transformation unseres Körperumgangs auch außerhalb des Netzes entwickeln. Das Bild, das wir uns von unserem realen Körper machen, kommt durch die virtuellen Gegenbilder, die wir im Netz experimentell erkunden, in Bewegung – und mit diesem Bild kommt auch der reale Körper selbst in seiner nichtzeichenhaften Materialität in Bewegung. Indem wir anerkennen, daß unser realer Körper in seiner Materialität nicht selbst ein Zeichen, sondern der nichtzeichenhafte und interpretationstranszendente Effekt unseres Zeichenumgangs ist, beginnen wir zu realisieren, daß auch und gerade der reale, materielle Körper in Abhängigkeit von der Art und Weise seiner Signifikation in der ihm eigenen, nichtzeichenhaften Realität gestaltbar und transformierbar ist.
Vor diesem Hintergrund wird abschließend deutlich, warum es körperphilosophisch zu nichts führt, auf unseren Körper (bzw. unser ‚Leibapriori‘) irgendwie andächtig zu ‚hören‘. Als nichtzeichenhafte Realität spricht unser Körper nicht von sich aus. Wir können unseren Körper jedoch zum Sprechen bringen, indem wir die medialen Konstellationen und die mit ihnen verbundenen Körpererfahrungen und Körperdiskurse pragmatisch verändern. Der Körper artikuliert sich an der Schnittstelle unterschiedlicher Erfahrungen und Diskurse genau dann, wenn wir aktiv und offen an seiner Gestaltung als einer nichtzeichenhaften Entität arbeiten. Wir ‚erkennen‘ unseren Körper im pragmatischen Prozeß seiner semiotisch grundierten (aber nicht allein und nicht primär diskursiven) Transformation. Dazu bedarf es der bewußten Entwicklung und anspruchsvollen Ausdifferenzierung von handwerklich-künstlerischen, also poietischen Techniken der Körpererfahrung. Die Eigensemiotik des Körpers kann sich uns ein Stück weit zwar bereits durch das Internet erschließen. Die Übertragung der im Internet gemachten Dekonstruktionserfahrungen auf das Leben außerhalb des Netzes aber setzt poietische Körperzugänge voraus, die in der westlichen Kultur bisher unterentwickelt sind.
Unsere realen Körper sind sexuell und oberflächenästhetisch überbesetzt, aber lebenskünstlerisch und alltagstherapeutisch für private und öffentliche, sinnliche und intelligible Formen der Körpererfahrung kaum erschlossen, wie sie etwa in der chinesischen Körperkunst des Tai Chi Chuan aufscheinen oder von Moshé Feldenkrais27 und F. Matthias Alexander28 beschrieben worden sind. Vielleicht kann die pragmatische Dekonstruktion menschlicher Körperlichkeit, die sich mit den interaktiven Kommunikationsdiensten des Internet verbindet, einen Anstoß dazu geben, dieses kulturelle Defizit Schritt für Schritt zu beheben. Würden die (im philosophischen Sinn ‚posthumanistischen‘) Gestaltungsspielräume, die sich auf diesem Weg entwickeln lassen, bildungspolitisch intelligent umgesetzt und soziopolitisch konsequent ausgeschöpft, könnte dies zum Fortschritt des politischen Humanismus beitragen.29 Dessen Ziel besteht darin, daß immer mehr Menschen lernen, immer weniger grausam und immer weniger demütigend mit den eigenen und mit fremden Körpern, Gefühlen und Gedanken umzugehen.
1 Annette Barkhaus und Anne Fleig, „Konzept der Arbeitstagung: Grenzverläufe. Der Körper als Schnittstelle“, Februar 1999, S. 1.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Ebd.
5 Peter Sloterdijk, Zur Kritik der zynischen Vernunft. Ein Essay, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983; Zur Welt kommen – zur Sprache kommen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1988; ders., Sphären, Bd. 1: Blasen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1998.
6 Richard Shusterman, „Die Sorge um den Körper in der heutigen Kultur“, in: Philosophische Ansichten der Kultur der Moderne, hrsg. von Andreas Kuhlmann, Frankfurt a.M., Fischer, 1995, S. 241-277; ders., Vor der Interpretation. Sprache und Erfahrung in Hermeneutik, Dekonstruktion und Pragmatismus, Wien, Passagen, 1996.
7 Hartmut Böhme und Gernot Böhme, Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1983; Gernot Böhme, Natur, Leib, Sprache. Die Natur und der menschliche Leib, Delft, Eburon, 1986; ders., „Über die Natur des Menschen“, im vorliegenden Band, S. #-#.
8 Leib-Maschine-Bild. Körperdiskurse der Moderne und Postmoderne, hrsg. von Elisabeth List und Erwin Fiala, Wien, Passagen, 1997; Elisabeth List, „Selbstverortungen. Zur Restituierung des Subjekts in den Diskursen um den Körper“, im vorliegenden Band, S. #-#.
9 Zur Philosophiegeschichte des Leibapriori in der Moderne vgl. Stephan Grätzel, Die philosophische Entdeckung des Leibes, Stuttgart, Steiner, 1989.
10 Für analoge Einsichten, die sich bereits bei Hegel und neuerdings in der analytischen Gegenwartsphilosophie finden, vgl. Wolfgang Welsch, „Hegel und die analytische Philosophie“, in: Information Philosophie, Heft 1/2000, S. 7-23, insbes. S. 20ff. Vgl. hierzu auch Samuel C. Wheeler III, Deconstruction as Analytic Philosophy, Stanford, Stanford University Press, 2000.
11 Derridas Denken der différance ist körperphilosophisch konsequent insbesondere von Judith Butler ausbuchstabiert worden. Vgl. hierzu exemplarisch den Titelaufsatz ihres Buchs Körper von Gewicht. Gender Studies, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1997, S. 53-87. In diesem Aufsatz macht sich Butler zurecht über die folgende Frage lustig, die sich aus dem von mir eingangs erwähnten populardekonstruktivistischen Derrida-Mißverständnis ergibt: „Wenn alles Diskurs ist, was passiert dann mit dem Körper?“ (Butler, „Körper von Gewicht“, in: dies., Körper von Gewicht. Gender Studies, a.a.O., S. 53) Daß diese Frage mit Blick auf Derrida falsch gestellt ist, zeigt Butler, indem sie die dialektische Gedankenbewegung der différance wie folgt rekonstruiert: „Der als dem Zeichen vorgängig gesetzte Körper wird immer als vorgängig gesetzt oder signifiziert. (...). Vermittels der Sprache eine Materialität außerhalb der Sprache zu setzen heißt immer noch, jene Materialität zu setzen, und die so gesetzte Materialität wird diese Setzung als ihre konstitutive Bedingung behalten" (Butler, a.a.O., S. 56f).
12 Vgl. hierzu Mike Sandbothe, „Die pragmatische Wende des linguistic turn“, in: Die Renaissance des Pragmatismus. Aktuelle Verflechtungen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie, hrsg. von Mike Sandbothe, Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 2000, S. 96-126.
13 Für eine systematische Analyse der Unterschiede und Verflechtungsmöglichkeiten, die zwischen theoretizistischen und pragmatischen Konzeptionen von Medienphilosophie bestehen, siehe Mike Sandbothe, Pragmatische Medienphilosophie. Grundlegung einer neuen Disziplin im Zeitalter des Internet, Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 2001 (im Druck).
14 Vgl. hierzu exemplarisch Richard Shusterman, „Soma und Medien“, in: Medien-Welten-Wirklichkeiten, hrsg. von Gianni Vattimo und Wolfgang Welsch, München, Fink, 1998, S. 113-126.
15 Vgl. hierzu und zum folgenden Richard Rorty, Hoffnung statt Erkenntnis. Eine Einführung in die pragmatische Philosophie, Wien, Passagen, 1994, insbes. Kapitel III, S. 67-89; ders., Stolz auf unser Land. Die amerikanische Linke und der Patriotismus, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1999; ders., Philosophy and Social Hope, London, New York u.a., Penguin, 1999; ders., Philosophie und die Zukunft, Frankfurt a.M., Fischer, 2000.
16 Richard Rorty, „Der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie“, in: ders., Solidarität oder Objektivität? Drei philosophische Essays, Stuttgart, Reclam, 1988, S. 82-125.
17 Krämer, „Virtualisierung oder: Über die Verwandlung von Körpern in Zeichen für Körper“, a.a.O., S. 1#.
18 Ebd.
19 In diesem Sinn stellt Stefan Münker in seinem Beitrag zum vorliegenden Band mit Blick auf Telefon und Internet heraus, „dass auch das mediale Handeln und virtuelle Kommunizieren nicht ohne Körper auskommt“ (Stefan Münker, „Vermittelte Stimmen, elektrische Welten. Anmerkungen zur Frühgeschichte des Virtuellen“, im vorliegenden Band, S. #-#, hier: S. #).
20 Krämers kontraintuitive Grundthese, die sich aus ihren Arbeiten zu formalen Sprachen und symbolischen Maschinen speist (Sybille Krämer, Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriß, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988), besteht in der Annahme, „daß die telematische Interaktivität nicht mehr nach dem Vorbild einer Interaktion zwischen menschlichen Personen, sondern zwischen symbolischen Entitäten zu interpretieren ist“ (Krämer, a.a.O., S. 1#). Diese Annahme verabsolutiert die symbolisch-technische Basis der Computerkommunikation auf Kosten der intersubjektiv-pragmatischen Gebrauchsebene der Chatdienste.
21 Krämer, ebd.. Insgesamt fällt Krämer in den Schlußüberlegungen ihres Aufsatzes, in denen sie die „Körperlichkeit des Sprechens“ (Krämer, a.a.O., S. 5#) zum entscheidenden Kriterium für authentische Kommunikation erklärt, in alte phonozentrische Denkgewohnheiten zurück – und zwar im Sinn eines umgekehrten Platonismus. Während die Stimme für den platonischen Phonozentriker die Präsenz des den Körper spirituell transzendierenden Geistes fundiert, sichert sie bei Krämer die Präsenz des den Geist materialisierenden Körpers. In beiden Fällen ist die Stimme am Leitfaden des von Derrida dekonstruierten „System[s] des ‚Sich-im-Sprechen-Vernehmens‘“ (Derrida, Grammatologie, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1983, S. 19) gedacht. Sie fungiert nicht als ein pragmatisches Kommunikationsmedium neben anderen pragmatischen Kommunikationsmedien, sondern wird zu einem epistemischen Tertium stilisiert, das sich im Akt seines Vollzugs selbst zum Verschwinden bringen und auf diesem Weg die authentische Präsenz einer medienfreien Einheit von Geist und Körper garantieren soll.
22 Vgl. Mike Sandbothe, Die Verzeitlichung der Zeit. Grundtendenzen der modernen Zeitdebatte in Philosophie und Wissenschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. Zur medienphilosophischen Anwendung auf das Internet siehe ders., „Virtuelle Temporalitäten. Zeit- und identitätsphilosophische Aspekte des Internet“, in: Identität und Moderne, hrsg. von Alois Hahn und Herbert Willems, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1999, S. 363-386
23 Zum Konzept der Revalidierung vgl. Wolfgang Welsch, „Eine Doppelfigur der Gegenwart“, in: Medien-Welten-Wirklichkeiten, hrsg. von Gianni Vattimo und Wolfgang Welsch, München, Fink, 1997, S. 229-248.
24 Vgl. Amy Bruckman, „Gender Swapping On The Internet“, in: Proceedings of INET '93, Reston, VA, The Internet Society, 1993 sowie Sherry Turkle, Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet, Reinbek, Rowohlt, 1998, insbes. S. 340-377.
25 Krämer, a.a.O., S. 3.
26 Vgl. Mike Sandbothe, „Ist das Internet cool oder hot? Zur Aktualität von McLuhans Vision medialer Gemeinschaft“, in: Das Andere der Kommunikation, hrsg. von Wolfgang Luutz, Leipzig, Leipziger Schriften zur Philosophie, 1997, 107-122; ders., „Transversale Medienwelten. Philosophische Überlegungen zum Internet“, in: Medien-Welten-Wirklichkeiten, hrsg. von Gianni Vattimo und Wolfgang Welsch, München, Fink, 1998, 59-84, insbes. S. 60ff.
27 Moshé Feldenkrais, Die Entdeckung des Selbstverständlichen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1987; ders., Bewußtheit durch Bewegung. Der aufrechte Gang, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1996.
28 Frederick Matthias Alexander, Constructive Conscious Control of the Individual, New York, E.P. Dutton, 1923 (auch in: Alexander Technique: Original Writings of F.M. Alexander, hrsg. von Daniel McGowan, Burdett/NY, Larson, 1997).
29 Vgl. Mike Sandbothe, „Pragmatic Media Philosophy and Media Education“, in: Enquiries at the Interface: Philosophical Problems of On-line Education. A Special Issue of The Journal of Philosophy of Education, hrsg. von Paul Standish und Nigel Blake, Oxford, Blackwell, 2000, S. 53-69.