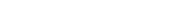Druckfassung in: Identität und virtuelle Beziehungen im Computerspiel, hrsg. von Clemens Bohrer und Bernadette Schwarz-Boenneke, München: kopaed 2010, S. 75-82.
Mike Sandbothe
Computerspielsucht und Suchtkultur
Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind die sechs Suchtkriterien, die Beutel et al. in ihrem Beitrag zum vorliegenden Band zur klassifikatorisch-diagnostischen Bestimmung der Computerspielsucht zugrunde legen.1
Die ersten drei Kriterien beziehen sich auf das Verhältnis des Spielers zum Spielen von Computergames. Dabei besteht Kriterium 1 in dem unwiderstehlichen Verlangen nach Ausübung der Spielaktivität (Craving). Beim Spielen selbst kommen zwei weitere Merkmale von Sucht zum Tragen: die Verminderung der Kontrollfähigkeit bezüglich Beginn, Dauer und Beendigung der Spielaktivität (Kontrollverlust) sowie die schrittweise Steigerung der Spielhäufigkeit (Toleranzentwicklung).
Im Unterschied zu den Kriterien 1-3 beziehen sich die Merkmale 4-6 nicht auf das Verhältnis des Spielers zum Spielen selbst. Stattdessen geht es um Nebeneffekte, die sich aus der süchtigen Spielpraxis ergeben.
Dabei besteht das vierte Suchtkriterium in den Entzugserscheinungen, die bei fehlender Spielaktivität auftreten: Nervosität, Unruhe, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Aggressivität. Kriterium 5 rekurriert darüber hinaus auf den Sachverhalt, dass Lebensbereichsbeschränkungen in Kauf genommen werden, d.h. dass früher als angenehm empfundene Tätigkeiten (wie z.B. Tanzengehen, Fußballspielen oder Fernsehen) zugunsten des Computerspielens vernachlässigt werden. Das sechste Merkmal schließlich hat mit der Bereitschaft von Computerspielsüchtigen zu tun, das Spielen trotz negativer Konsequenzen (wie Leistungsabfall, Übermüdung oder sozialen Konflikten) fortzusetzen (Inkaufnehmen negativer Konsequenzen).
Alle sechs Suchtkriterien stammen aus dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Sie wurden von Grüsser et al. in leicht modifizierter Form auf die Computerspielsucht übertragen.2 Beim DSM handelt es sich um einen seit 1952 von der American Psychiatric Association herausgegebenen Kriterienkatalog für psychische Krankheiten. Die Entwicklung dieses Klassifikationsinstruments geht zurück auf Volkszählungen im 19. Jahrhundert sowie auf die statistische Erfassung von Psychopathologien bei US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg.
Heilungsorientierter Pragmatismus
Aus pragmatistischer Perspektive erscheint es mir wichtig, deutlich zu unterscheiden zwischen der klassifikatorischen Bestimmung von Computerspielsucht und einem komplexeren Problemverständnis. Während die erstere zumeist im Rekurs auf Manuals wie das DSM oder die International Classification of Diseases (ICD) entwickelt wird, ergibt sich letzteres aus einer stärker therapeutisch ausgerichteten Perspektive.
Über bestimmte Aspekte der verhaltenstherapeutischen Sicht informieren Wölfling et al. in ihrem Beitrag zum vorliegenden Band.3 Im Folgenden möchte ich darüber hinaus zeigen, dass es aus pragmatistischer Perspektive Sinn macht, sich für so etwas wie den Vorrang der therapeutischen vor der klassifikatorischen Perspektive auszusprechen.
Die Denkströmung des amerikanischen Pragmatismus wird prominent u.a. von John Dewey (1859-1952), Richard Rorty (1931-2007) und Robert Brandom (1950ff) vertreten.4 Einer der Grundzüge dieser philosophischen Bewegung besteht darin, wissenschaftliche Theorien nicht in erster Linie als Abbildungen oder Konstruktionen einer adäquat zu beschreibenden Realität aufzufassen. Stattdessen schlagen die Pragmatisten vor, Wissenschaft als eine Werkzeugkiste zu sehen. In dieser Kiste liegen eine Reihe von Theorie-und-Empirie-Tools, deren konkreter Wert sich nach ihrer Nützlichkeit für die menschliche Lebensqualität bemisst.
Pragmatistische Überlegungen zum Thema Computerspielsucht legen aus diesem Grund einen besonderen Schwerpunkt auf detaillierte Einzelfallbeschreibungen und die sich daraus ergebenden netzwerkartigen „Familienähnlichkeiten“ (Wittgenstein). Dem damit verbundenen Erfahrungswissen kommt mit Blick auf den ärztlichen Heilungserfolg im Regelfall eine höhere therapeutische Bedeutsamkeit zu als der abstrakten Konstruktion eines allgemeinen Krankheitsbildes, das den (zum Teil anachronistischen) klassifikatorischen Standards von DSM-IV-TR oder ICD-10 entspricht.
Damit will ich nicht sagen, dass die Auflistung von Computerspielsucht in den genannten Manuals keine Relevanz hätte. Denn auch für das Klassifikationsinteresse gibt es natürlich eine pragmatische Motivation. Aber dabei stehen nicht die konkreten therapeutischen Lösungswege im Vordergrund. Diese sind mit Blick auf einzelne Menschen zu entwickeln, die im Rahmen ihrer individuellen Biographien Probleme mit Computerspielen haben. Die Eintragung in den klassifikatorischen Manuals bezieht sich demgegenüber auf ein statistisches Durchschnittsphänomen. Dessen professionelle Konstruktion hat gesundheits- und wissenschaftspolitisch wichtige Legitimationsfunktionen.
Die Sicherstellung der krankenkassentechnischen Abrechnungsmöglichkeiten und der Gewährung von Forschungsförderung sollte jedoch nicht ohne Not mit dem heilungsbezogenen Pragmatismus eines therapeutisch grundierten Lösungsansatzes vermischt werden. Leider ist diese Verschleifung jedoch sowohl in der ärztlich-therapeutischen als auch in der wissenschaftlichen Verwendung von Klassifikationsrastern wie DSM-IV-TR und ICD-10 allzu häufig zu beobachten.
Genau an diesem Punkt sehe ich auch eine gewisse Schwachstelle der Forschungsergebnisse, die Beutel et al. in ihrem bereits erwähnten Aufsatz referieren. Der Verweis auf konkrete Fälle dient in diesem Text in erster Linie dazu, die von Grüsser et al. aus dem DSM übernommenen Suchtkriterien am eigenen Patientenmaterial zu exemplifizieren. Die Individualität der unterschiedlichen Fälle der Mainzer Suchtambulanz und damit die Vielschichtigkeit der Probleme, die einzelne Menschen im Rahmen ihrer spezifischen Lebensgeschichte mit bestimmten Computerspielen haben, kommen dabei zu kurz.
Mit diesem Einwand lässt sich die wissenschaftsphilosophische Kritik an einem bestimmten, auch und gerade in Psychologie und Psychiatrie weit verbreiteten Forschungstypus verbinden. Damit meine ich das - wie Pragmatisten es nennen - repräsentationalistische Verständnis wissenschaftlicher Arbeit.
Dieses Verständnis und die damit verbundenen psychologischen und psychiatrischen Forschungsmethoden gehen von einem systematischen Vorrang des abstrakten Klassifikationsrahmens vor der spezifischen Diagnose aus, die in diesem Rahmen zu erstellen ist. Die solchermaßen klassifikatorisch vorstrukturierte Diagnose wird dann ihrerseits mit einem Primat gegenüber der jeweils indizierten Einzel- bzw. Gruppen-Therapie ausgezeichnet.5 Aus pragmatistischer Sicht ist die darin zum Ausdruck kommende Hierarchie von Klassifikation, Diagnose und Therapie zu problematisieren.
Als repräsentationalistisch bezeichne ich ein Verständnis von Wissenschaft, dessen zentrales Forschungsziel darin besteht, eine adäquate Vorstellung (repraesentatio) des Forschungsgegenstandes zu geben. Diese repraesentatio kann dabei als Abbildung einer vorgegebenen Realität - also eines Gegenstandes im realistischen Sinn - oder als Re- bzw. Dekonstruktion eines schematischen Vorentwurfs - also eines Gegenstandes im konstruktivistischen Sinn - verstanden werden.
Auch der Pragmatismus arbeitet mit dem Begriff des Forschungsgegenstandes. Aber aus seiner Sicht sind Gegenstände weder als reale noch als konstruierte Entitäten zu beschreiben, die es zu klassifizieren bzw. zu repräsentieren, d.h. zu erkennen gilt. Stattdessen spielen sie eine wichtige Rolle als Elemente sprachlicher Praktiken, die zum Gedeihen der menschlichen Spezies beitragen können oder auch nicht.
Aus pragmatistischer Sicht erscheint wissenschaftliche Forschung nicht als ein theoretischer Erkenntnisprozess, zu dem die praktische Anwendung erst sekundär als Supplement hinzukommt. Vielmehr wird Forschung als ein genuin praktischer Prozess aufgefasst, in dem es von Anfang bis Ende ums ‚coping’, also um Gestaltung und Veränderung, um Problemlösung und Therapie geht.
Schon die vermeintliche Grundlagenfrage nach der Existenz eines Forschungsgegenstandes wird aus diesem Grund von Pragmatisten wie Dewey, Rorty oder Brandom einer kulturpolitischen, d.h. normativen Nützlichkeitsbewertung unterzogen.6
Bezogen auf die suchtartigen Probleme, die Menschen im Umgang mit Computerspielen entwickeln können, bedeutet der skizzierte pragmatic turn, dass die Frage, ob es Computerspielsucht gibt, durch eine andere Frage zu ersetzen ist. Diese lautet: Ist es therapeutisch hilfreich, also der Heilung dienlich, von der Existenz des Phänomens der Computerspielsucht auszugehen?
Da ich selbst nicht therapeutisch erfahren bin im Umgang mit Menschen, die suchtartige Probleme mit Computerspielen haben, kann ich keine direkte Antwort auf diese Frage geben.7 Was ich stattdessen zum Abschluss meiner Überlegungen tun möchte, ist den Rückbezug auf die anfangs erwähnten sechs Suchtkriterien herzustellen.
Suchtkultur und Kulturtherapie
Einerseits hat man den Eindruck, dass Craving, Kontrollverlust, Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen, Lebensbereichsbeschränkungen und Inkaufnehmen negativer Konsequenzen tatsächlich zu den Problemen gehören, die Menschen mit Computerspielen haben können. Andererseits ist aber die Frage zu stellen, ob diese Kriterien ausreichen, um einen pathologischen Sachverhalt zu diagnostizieren.
Schaut man sich die aktuelle kulturelle Situation in postindustriellen Gesellschaften wie der unseren etwas genauer an, dann fällt auf, dass Craving, Kontrollverlust, Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen, Lebensbereichbeschränkungen und Inkaufnehmen negativer Konsequenzen überaus weit verbreitete Grundsachverhalte unserer Lebensform darstellen. Einen guten Einblick in die kulturpolitischen Zusammenhänge, die zwischen Medien, Werbung, Wirtschaft und Suchtphänomenen bestehen, gibt ein Internet-Video der amerikanischen Stadtplanerin Annie Leonard. Es trägt den Titel The Story of Stuff und ist im World Wide Web unter der Adresse www.storyofstuff.com zu finden. 8
Wenn es stimmen sollte, dass Suchtphänomene aus ökonomischen Gründen gezielt produziert werden und weiterhin gilt, dass die sechs Suchtkriterien Indices für eine vorliegende Suchtkrankheit sind, dann würde daraus folgen, dass wir möglicherweise in einer selbst als pathologisch zu bezeichnenden Suchtkultur leben.
Ein nahe liegendes Beispiel für die kulturelle Allgegenwärtigkeit des durch die sechs Kriterien definierten Suchtphänomens wäre etwa das Verhältnis, das vermutlich die meisten der in diesem Buch publizierenden Experten zu ihrer eigenen akademischen Arbeit haben.
Um einen guten Vortrag zu halten oder einen ordentlichen Aufsatz bzw. ein Buch zu schreiben, ist das unwiderstehliche Verlangen nach der Arbeit an dem entsprechenden Forschungsgegenstand eine wichtige Voraussetzung (Craving). Wenn der Wissenschaftler gut im Flow ist, verliert er beim Forschen, Schreiben, Präsentieren schnell die Kontrolle über das eigene Zeitgefühl (Kontrollverlust). Und wenn es um neue, ehrenvolle Anfragen geht, ist er sehr tolerant und überlädt seinen Terminkalender gnadenlos (Toleranzentwicklung).
Auch die zu Beginn erwähnten Nebeneffekte, die aus Craving, Kontrollverlust und Toleranzentwicklung resultieren können, sind den zur Wissenschaft berufenen Menschen oft aus eigenem Erleben gut bekannt.
Die meisten von uns haben ein ambivalentes Verhältnis zu den Entzugserscheinungen, die vor allem in den ersten Urlaubstagen auftreten, wenn keine Bibliothek in der Nähe ist und kein Computer in Reichweite. Ich selbst habe im Studium nach der Zwischenprüfung das Schlagzeugspielen aufgegeben. Denn ich hatte mich entschlossen, ganz und gar meiner Lese- und Studiersucht zu frönen und dafür Lebensbereichsbeschränkungen zu akzeptieren. Und die negativen sozialen Konsequenzen, die der suchtartige Umgang mit den akademischen Lehr- und Forschungsaufgaben hinsichtlich der eigenen Familie oder des Freundeskreises haben kann, sind den meisten von uns schmerzvoll bewusst.
Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Tatsächlich glaube ich, dass die von Grüsser et al. aus dem DSM übernommenen Suchtkriterien auf eine sehr große Anzahl von Gewohnheiten zutreffen, die in unserer Gesellschaft zum Alltag gehören. Neben der Arbeitssucht gibt es nicht nur die Shopping-Sucht, die Sex-Sucht, die Sport-Sucht und die Drogen-Sucht, sondern auch suchtartige Phänomene, die sich auf’s Autofahren, auf’s Fliegen, auf’s Fleischessen, auf’s Kaffeetrinken, auf den Lebenspartner bzw. die Lebenpartnerin (Koabhängigkeit), auf den Konsum von Pornographie, auf’s Geld, auf’s Handy, auf diverse andere Medien und (nicht nur bei Philosophen und Depressiven, sondern auch bei vielen Normalen) sogar auf’s Nachdenken beziehen können.9
Liege ich mit dieser Beobachtung richtig, dann wäre die so genannte Computerspielsucht nur eine von vielen Ausdrucksformen der in unserer Kultur weit verbreiteten Neigung, sich von einem bestimmten Stoff oder einer bestimmten Verhaltensweise bzw. Stimulationsform abhängig zu machen. Vor diesem Hintergrund würde der pragmatistische Vorrang der Therapie vor der Klassifikation eine Erweiterung erfahren.
Die kulturtherapeutisch reformulierte Leitfrage lautete dann: Ist es therapeutisch hilfreich, also der Heilung unserer kulturellen Lebensform dienlich, von der Existenz des Phänomens der Sucht auszugehen? Bejaht man diese Frage, dann gibt man dem Terminus Suchtkultur eine soziologische Beschreibungsqualität und fragt sich darüber hinaus, wie therapeutische Heilungsarbeit mit Blick auf unsere Kultur aussehen kann.
Beenden möchte ich meine Ausführungen mit einem Zitat und dem Hinweis auf ein interaktives Webseminar. Das Zitat stammt von dem englischen Schriftsteller Aldous Huxley. Es bezieht sich auf die Trennlinie, die man zwischen den klassischen, psychologisch-psychiatrischen Therapieformen auf der einen Seite und einer pragmatistischen Kulturtherapie auf der anderen ziehen kann. 1952 schrieb Huxley in seinem noch heute wegweisenden bildungsphilosophischen Aufsatz „The Education of an Amphibian“:
„The aim of the psychiatrist is to teach the (statistically) abnormal to adjust themselves to the behavior patterns of a society composed of the (statistically) normal. The aim of the educator in spiritual insight is to teach the (statistically) normal that they are in fact insane and should do something about it."10
„Das Ziel des Psychiaters ist es, den (statistisch) anormalen Menschen dabei zu helfen, sich an die Verhaltensmuster einer Gesellschaft anzupassen, die aus (statistisch) normalen Menschen besteht. Das Ziel des spirituellen Lehrers besteht darin, den (statistisch) normalen Menschen beizubringen, dass sie in Wirklichkeit krank sind und etwas dagegen tun sollten.“ (Übersetzung M.S.)
Wie man das Fernsehen für die Durchführung der von Huxley visionär beschriebenen pragmatistischen Kulturtherapie einsetzen könnte, hat Oprah Winfrey im vergangenen Jahr vor Augen geführt. Zusammen mit dem spirituellen Lehrer Eckhart Tolle hat die berühmte amerikanische TV-Moderatorin zehn Oprah Winfrey Shows produziert und via Internet weltweit mit großem Erfolg ausgestrahlt.11 Die Sendungen sind als syllabus zu den zehn Kapiteln von Tolles Bestseller A New Earth (2005) konzipiert.12
Auch wenn die spirituellen Praktiken von Tolle sicherlich im akademischen Bereich als zu esoterisch empfunden werden dürften, so handelt es sich hier doch um ein interessantes Beispiel dafür, wie man die globale Suchtkultur mit Hilfe der neuen Medien kulturtherapeutisch verändern könnte.13 Weniger esoterisch und medial zugleich weniger avanciert haben auch in Deutschland einflussreiche Entertainer und kulturtherapeutische Grenzgänger wie Hape Kerkeling14 oder Eckart von Hirschhausen15 vor Augen geführt, dass es in unserer Kultur durchaus so etwas wie einen Heilungsbedarf für die „statistisch Normalen“ (Huxley) gibt.
[1] Manfred E. Beutel, Julia Hoch, Kai Müller, Anke Quack und Klaus Wölfling: „Computerspiel und Internetnutzung – Problematisches und süchtiges Verhalten: Diagnostik, Ursachen und Verbreitung”, im vorliegenden Band, S.#-#.
[2] R. Thalemann, U. Albrecht, C.N. Thalemann und S.M. Grüsser, „Fragebogen zum Computerspielverhalten bei Kindern (CSVK). Entwicklung und psychometrische Kennwerte“, in: Psychomed, 16(4), 2004, S. 226–233.
[3] Klaus Wölfling, K.W. Müller und Manfred E. Beutel, „Computerspiel- und Onlinesucht – Psychotherapeutische Erfahrungen aus der Ambulanz für Spielsucht“, im vorliegenden Band, S.#-#.
[4] Vgl. hierzu auch: Die Renaissance des Pragmatismus, hrsg. von Mike Sandbothe, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2000; Pragmatismus als Kulturpolitik, hrsg. von Alexander Gröschner und Mike Sandbothe, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2010.
[5] Vgl. hierzu auch Wölfling et al., die im vorliegenden Band die repräsentationalistische Ansicht vertreten, dass eine Diagnose im klinischen Prozess „zwingend notwendig“ sei (Wölfling et al., im vorliegenden Band, S. #).
[6] Vgl. hierzu exemplarisch Richard Rorty, „Kulturpolitik und die Frage der Existenz Gottes“, in: ders., Philosophie als Kulturpolitik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, S. 15-55.
[7] Einen Schritt weiter geht hier Alexander Gröschner, „Suchtkultur versus Lernkultur? Pragmatistische Überlegungen zu den Risiken und Chancen von Computerspielen im Kindes- und Jugendalter“, im vorliegenden Band, S. #-#.
[8] Für die im aktuellen Zusammenhang besonders relevante Sequenz siehe http://www.sandbothe.net/813.html.
[9] Vgl. hierzu aus anderer Perspektive und mit anderen Konsequenzen: Manfred Lütz, Irre – Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2009.
[10] Aldous Huxley: „The Education of an Amphibian“ in: Aldous Huxley, Adonis and the Alphabet and Other Essays, London: Chatto&Windus 1956, S. 33.
[11] A New Earth Class Syllabus: Online-Publikation (Videos, Audios, Transkripte), http://www.oprah.com/article/oprahsbookclub/anewearth/20080130_obc_webcast_syllabus.
[12] Eckart Tolle: A New Earth. Awakening To Your Life’s Purpose, New York: Dutton/Penguin 2005 (dt. Ausgabe: Eine neue Erde. Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung, München: Arkana 2005).
[13] Vgl. hierzu auch Mike Sandbothe, „Wozu Medienkonvergenz? Pragmatistische Überlegungen zu einem ökologischen Medienbegriff“, Online-Publikation: 2009, http://www.sandbothe.net/844.html.
[14] Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg, München: Malik 2006.
[15] Eckart von Hirschhausen, Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Kurioses aus der Medizin, Reinbek: Rowohlt 2008. Ders., Glück kommt selten allein, Reinbek: Rowohlt 2009.