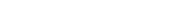Ringvorlesung: Medienkonvergenz und Neue Medien, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Institut für Medienwissenschaft, 26. November 2009, Brechtbau, HS 037, 18-20 Uhr.
Mike Sandbothe
Wozu Medienkonvergenz?
Pragmatistische Überlegungen zu einem ökologischen Medienverständnis (Vortragsmanuskript)
Auf dem Werbeplakat und in der Ankündigung zu dieser Ringvorlesung werden als Leitthemen die folgenden drei Fragen genannt:
- „Was braucht man, um in den Medienwelten von übermorgen zu bestehen?“
- „Wie verändern sich Recherche, Präsentationsformen, Nutzungsgewohnheiten?“
- „Was treibt den Medienwandel?“1
Eine einheitliche Antwort auf alle drei Fragen findet sich im Titel der Ringvorlesung. Die Lösung lautet: Medienkonvergenz. Verwendet man diesen Schlüsselbegriff zur Beantwortung der drei Ankündigungsfragen, dann ergeben sich die drei folgenden Antwortsätze:
- Medienkonvergenz treibt den aktuellen Medienwandel.
- Medienkonvergenz markiert den Veränderungsmodus für Recherche, Präsentationsformen und Nutzungsgewohnheiten.
- Medienkonvergenzkenntnisse sind wichtig, um in den Medienwelten von übermorgen zu bestehen.
Wie Sie wissen, lautet der Titel meines heutigen Vortrags: „Wozu Medienkonvergenz? Pragmatistische Überlegungen zu einem ökologischen Medienverständnis“. Wenn Sie sich vor dem Hintergrund dieser Titelformulierung die drei soeben aufgezählten Antwortsätze vergegenwärtigen, dann sieht es so aus, als ob die Titelfrage meines Beitrags damit im Grunde schon beantwortet ist.
Wozu dient der Begriff Medienkonvergenz bzw. wozu brauchen wir Medienkonvergenzforschung? Antwort:
- Um den aktuellen Medienwandel zu beschreiben.
- Um den Veränderungsmodus für Recherche, Präsentationsformen und Nutzungsgewohnheiten zu bestimmen.
- Um in den Medienwelten von übermorgen zu bestehen.
So weit, so gut. Und doch: meine Wozu-Frage hat noch eine andere Komponente. Sie bezieht sich nicht allein und nicht primär auf den Medienkonvergenzbegriff bzw. die Medienkonvergenzforschung, sondern auch und vor allem auf die damit verbundenen Sachverhalte. Das macht einen wichtigen Unterschied.
Medienkonvergenz - Begriff und Sachverhalt
Wie Sie alle wissen, beginnt in Kopenhagen in anderthalb Wochen (am 7. Dezember) die 15. UN-Klimakonferenz. Anhand des Begriffs global warming lässt sich eindringlich vor Augen führen, worin der Unterschied besteht zwischen einer Wozu-Frage, die sich auf einen Begriff, und einer Wozu-Frage, die sich auf die Sachverhalte bezieht, die mit diesem Begriff beschrieben werden.
Wenn man - ganz spielerisch - das Wort Medienkonvergenz in den drei Antwortsätzen von vorhin durch das Wort global warming ersetzt und das Resultat dann noch ein wenig umformuliert, ergibt sich die folgende Satzsequenz:
- Der Begriff global warming dient dazu, den aktuellen Klimawandel zu beschreiben.
- Mithilfe des Begriffs global warming lässt sich der Veränderungsmodus bestimmen, den wir gegenwärtig bezüglich der Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre, des weltweiten Wetters und der menschlichen Energienutzungsgewohnheiten beobachten.
- Global-Warming-Kenntnisse sind wichtig, um in den Klimawelten von übermorgen zu bestehen.
Das sind drei mögliche Antworten auf die Wozu-Frage nach dem Begriff global warming. Jedem von Ihnen ist dabei selbstverständlich klar, dass damit noch nichts darüber gesagt ist, wozu die globale Erderwärmung selbst – also der Sachverhalt als solcher - gut ist und mehr noch: ob sie überhaupt zu etwas gut ist oder nicht vielmehr schlecht.
Sie können sich schon denken, was daraus für die Frage „Wozu Medienkonvergenz?“ folgt. Mit Bezug auf die allgemeine Begriffsdefinition von Medienkonvergenz, die Ihnen aus dem Ankündigungstext zu dieser Ringvorlesung bereits geläufig ist, lässt sich meine Hauptfrage nun wie folgt formulieren:
- Wozu kann die „Verknüpfung und Verschmelzung von traditionell getrennt beschriebenen Kommunikations- und Mediensphären“2 (also deren Konvergenz) nützlich sein?
- Welchen Zwecken kann bzw. soll sie dienen?
- Welche Vor- und Nachteile können sich aus der Medienverschmelzung ergeben?
- Wem kann die Konvergenz nutzen? Wem kann sie schaden?
Und noch einmal normativer formuliert:
- Kann die Konvergenz der Medien ihren NutzerInnen (also den Menschen in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten Erde) zu mehr Lebensqualität verhelfen?
- Kann und soll die Verknüpfung der unterschiedlichen Mediensorten dazu beitragen, dass immer mehr Menschen immer besser und womöglich immer glücklicher leben?
- Oder wäre das zuviel verlangt?
- Ist Medienkonvergenz vielleicht ein neutrales, d.h. ein normativ nicht zu hinterfragendes Phänomen?
Im Ankündigungstext zu dieser Ringvorlesung werden vier Ebenen für die Betrachtung des Vorlesungsthemas vorgeschlagen3:
- Die Ebene der Technik (die Auflösung technisch geprägter Grenzen bzw. Übertragungswege und das Zusammenwachsen verschiedener Einzelmedien im Zuge der Digitalisierung). [Technische Ebene]
- Die Ebene der Branchen und Organisationen (die Fusion und Reorganisation von Medienunternehmen). [Wirtschaftliche Ebene]
- Die Ebene der Inhalte (Konvergenz von Angeboten und medialen Plattformen). [Symbolische Ebene]
- Die Ebene der Nutzung (die Veränderung der Nutzungsgewohnheiten bzw. eben die Beharrungstendenzen der Nutzer). [Performative Ebene]
Im Folgenden werde ich die normative Frage nach dem Nutzen und Nachteil von Medienkonvergenz für das menschliche Zusammenleben u.a. unter Berücksichtigung dieser vier Ebenen erörtern. Dem Untertitel meines Vortrags können Sie darüber hinaus entnehmen, dass ich Medienkonvergenz aus pragmatistischer Perspektive mit einem ökologischen Medienverständnis in Verbindung bringen möchte.
Was es damit – also mit dem Pragmatismus und der Medienökologie - auf sich hat, will ich Ihnen vorweg kurz erläutern:
Was ist Pragmatismus?
Im Juni 2007 ist der amerikanische Philosoph Richard Rorty im Alter von 75 Jahren in San Francisco gestorben. Bis kurz vor seinem Tod hat er in Kalifornien an der Stanford University am Department of Comparative Literature als Professor für vergleichende Literaturwissenschaft gelehrt. Neben Jürgen Habermas und Jacques Derrida darf Rorty zu den drei wichtigsten Philosophen der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gezählt werden. Sein intellektuelles Steckenpferd war der philosophische Pragmatismus.
Dabei handelt es sich um eine amerikanische Erfindung. In Cambridge, Boston und Chicago haben zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Autoren wie der Ingenieur und Logiker Charles Sanders Peirce (1839-1914), der promovierte Mediziner und Experimentalpsychologe William James (1842-1910) sowie der Philosoph und Pädagoge John Dewey (1859-1952) damit begonnen, ein neues Verständnis von Philosophie und Wissenschaft zu entwickeln.
Diesem Verständnis zufolge dienen philosophische Gedankengebäude, wissenschaftliche Theorien und empirische Forschungsmethoden nicht in erster Linie dazu, die Wahrheit über die Wirklichkeit herauszufinden. Stattdessen – so der Vorschlag der amerikanischen Pragmatisten - sei es an der Zeit, das primäre Anliegen kultur-, sozial- und naturwissenschaftlicher Forschung darin zu sehen, unseren Umgang mit der Wirklichkeit zu optimieren und zu unserem Vorteil zu gestalten.
Peirce, James und Dewey hatten in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts mit diesem Vorschlag vor allem in ihrem Heimatland viel Erfolg. In Europa jedoch hat man diese Art von ‚Nützlichkeitsphilosophie’ nie sonderlich ernst genommen. Und auch in den USA ebbte der Erfolg in den fünfziger Jahren zunehmend ab.
Das lag wohl vor allem daran, dass die klassischen Pragmatisten keine überzeugende Antwort auf die berechtigte Frage geben konnten, was denn eigentlich als entscheidendes Kriterium für die Optimierung unseres Wirklichkeitsumgangs – also für die Nützlichkeit eines Begriffs, einer Theorie oder einer Methode – zu gelten habe.
Genau an diesem Punkt hat Richard Rorty angesetzt. Ihm ist es in den letzten dreißig Jahren gelungen, dem pragmatistischen Denken zu einer weltweiten Renaissance zu verhelfen. Dabei liegt die besondere Überzeugungskraft von Rortys Denken, das häufig auch als Neopragmatismus bezeichnet wird, in seiner philosophischen Bescheidenheit.
Zur Beantwortung der Frage nach den pragmatistischen Nützlichkeitskriterien bemüht Rorty absichtlich keinerlei „philosophische Globalprinzipien“4. Statt dessen beschränkt er sich bewusst auf die historisch und kulturell einsozialisierten Ziele, Ideale und Utopien, die sich in den demokratischen Gesellschaften der westlichen Welt in den letzten zwei Jahrhunderten herausgebildet haben.
In seinen Überlegungen hebt Rorty hervor, dass sich in den demokratischen Nationalstaaten der westlichen Welt zwei unterschiedliche Sorten von pragmatischen Grundorientierungen etabliert haben. Die eine Sorte ist privat und richtet sich auf die individuelle Selbstvervollkommnung. Die andere Sorte hat öffentlichen Charakter. Sie zielt auf die Verringerung von Grausamkeit und Demütigung sowie auf die Vermehrung von Solidarität im Zusammenleben der Menschen.
Aus Rortys Sicht ist es ein Glücksfall der Weltgeschichte, dass sich in den letzten 200 Jahren Staaten herausgebildet haben, die in ihren Kindergärten, Schulen und Universitäten jungen Menschen beibringen, wie man anständig miteinander umgehen und sich zugleich als Individuum kreativ fortentwickeln kann. Die darin zum Ausdruck kommende Idee einer schwachen und daher besonders unterstützungsbedürftigen Normativität stellt die praktische Grundlage des neopragmatistischen Denkens dar.
Akzeptiert man diese Grundlage, dann erscheinen Kunst, Medien und Wissenschaft als kulturpolitische Instrumente. Als solche tragen sie auf je spezifische Weise und in jeweils unterschiedlichen Graden zur Umsetzung und Ausbreitung der privaten und öffentlichen Ziele der Menschen in demokratischen Gesellschaften bei.
Die Kunst dient dabei ihrem Selbstverständnis nach mehr der privaten Vervollkommnung und die Wissenschaft mehr der Vermehrung von öffentlicher Solidarität. Die Medien, so könnte man sagen, zielen demgegenüber in besonderer Weise auf eine Balance zwischen privaten und öffentlichen Interessenlagen.
Das macht die Medien so interessant für Pragmatisten. Leider hat sich Rorty selbst an diesem Punkt - also der Schnittstelle von Medien und Pragmatismus – mit Hinweisen sehr zurückgehalten. Aus diesem Grund werde ich mich zur Erläuterung meines zweiten Titelstichworts – also der Medienökologie – auf den in Erfurt lehrenden Medien- und Kommunikationswissenschaftler Michael Giesecke stützen.
Was ist Medienökologie?
Auch sie ist eine amerikanische Erfindung. Und zwar stammt die Idee, nicht nur über die Biologie und die natürliche Umwelt, sondern auch über die technischen Medien aus ökologischer Perspektive nachzudenken, von Neil Postman (1931-2003). Der in New York lehrende Medien- und Kommunikationswissenschaftler gründete in den siebziger Jahren – also im gleichen Jahrzehnt als Rorty damit begann, den amerikanischen Pragmatismus wiederzubeleben - an der New York University den ersten Studiengang für Media Ecology.
Dabei konnte er sich auf Überlegungen des kanadischen Literaturprofessors und Mediengurus Marshall McLuhan (1911-1980) stützen. Im Unterschied zu McLuhan jedoch, der ein begeisterter Verteidiger des elektronischen Fernsehzeitalters war, spielte Postman den moralischen Humanismus der Gutenberg-Galaxis polemisch gegen die audiovisuellen Amüsierwelten der televisionären Kultur aus.
In Deutschland war es vor allem Peter Glotz (1939-2005), der sich für die Medienökologie einsetzte. An der Uni München hatte der ehemalige Berliner Wissenschaftssenator und langjährige Bundestagsabgeordnete in den neunziger Jahren eine Honorarprofessur für Medienökologie und Kommunikationskultur inne.
Zu einem ernstzunehmenden kommunikationswissenschaftlichen Forschungsparadigma wurde Medienökologie aber in der deutschsprachigen Debatte erst zu Beginn unseres Jahrhunderts. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Arbeiten von Michael Giesecke (geb. 1949).
Aus seiner Perspektive handelt es sich bei dem medienökologischen Forschungsprogramm um eine integrale Form medien- und kommunikationswissenschaftlichen Denkens. Traditionell befassen sich sowohl die kulturwissenschaftlich orientierte Medienforschung als auch die sozialwissenschaftlich ausgerichtete Kommunikationsforschung mit Gegenstandsbereichen, die in sich jeweils aus homogenen (also gleichartigen) Elementen bestehen. In der Medienwissenschaft sind das zumeist symbolische bzw. semiotische Strukturen, in der Kommunikationswissenschaft soziale bzw. wirtschaftliche Systeme.
Die medienökologische Sichtweise definiert ihren Gegenstandsbereich demgegenüber als ein System, in dem inhomogene (also artverschiedene) Elemente miteinander interagieren. Der damit verbundene integrale Aspekt der Medienökologie hat zwei verschiedene Dimensionen:
a) die integrative Analyse des über Technologien vermittelten Zusammenwirkens von symbolischen und semiotischen Strukturen mit sozialen und wirtschaftlichen Systemen.
b) Die Meta-Integration dieser technoökonomischen und soziosymbolischen Strukturen mit anderen artverschiedenen Elementen und zwar mit solchen, die bisher in den Medien- und Kommunikationswissenschaften keine ausreichende Berücksichtigung gefunden haben.
Die Fokussierung der zeitgenössischen Medien- und Kommunikationswissenschaft auf Menschen, Institutionen, Symbole und Techniken ist das Ergebnis einer kulturhistorischen Verengung der menschlichen Kommunikationspraxis. Nicht nur für die frühen Jäger und Sammler, sondern noch bis in die Neuzeit hinein spielten neben den genannte Kommunikatoren in der abendländischen Kultur auch Tiere und Pflanzen eine wichtige Rolle im Kommunikationssystem des Menschen.
Aus diesem Sachverhalt resultiert Gieseckes medienökologischer Vorschlag, „von vier möglichen artverschiedenen Kommunikatoren, Menschen, Tiere, Pflanzen und Technik“5 auszugehen. Eine derart holistisch verstandene Medienökologie lädt dazu ein, die aktuellen Konvergenzphänomene in einen weiter gefassten Horizont zu rücken.
Dieser Horizont umfasst neben den vier im Ankündigungstext genannten Verschmelzungsebenen – Techniken, Organisationen, Inhalten und Nutzungsformen - zusätzlich den Rückbezug auf die natürliche Welt von Pflanzen und Tieren und darüber hinaus auf das gesamte Ökosystem des Planeten Erde. Diese zweite, höherstufige Form von Konvergenz werde ich im Folgenden als Metakonvergenz bezeichnen.
Selbstverständlich bin ich mir darüber im Klaren, dass ein derart holistisches Verständnis von Medienkonvergenz Sie zunächst ein wenig irritieren wird. Dass Giesecke mit seinem Vorschlag aber durchaus etwas trifft, was sich derzeit in der medien- und kulturpolitischen Entwicklung spiegelt, möchte ich nun durch ein Videobeispiel vor Augen führen. Dabei handelt es sich um die Anfangssequenz von Al Gores Oscar-und-Nobelpreis-Film Eine unbequeme Wahrheit (2006).
Konvergenz und Metakonvergenz
Ich habe das als Beispiel ausgewählt, weil in dieser kurzen Filmpassage sowohl die einfache Konvergenz von Techniken, Institutionen, Inhalten und Nutzungsformen als auch die höherstufige Meta-Konvergenz von Mensch, Natur und Technik zum Ausdruck kommen.
Die unbequeme Wahrheit ist ein Film über eine Keynote-Präsentation. In der Keynote-Präsentation selbst sind bereits eine Vielzahl alter und neuer Medien zu einer digitalen Einheit verschmolzen, die dann ihrerseits noch einmal für Kino, Fernsehen und DVD reorganisiert worden ist.
Aber nun zu der Sequenz: Bei dem unter dem Namen „Erdaufgang“ berühmt gewordenen Bild, das Bill Anders 1968 vom Weltraum aus aufgenommen hat und das dann via Fernsehen weltweit ausgestrahlt wurde, handelt es sich ganz offensichtlich um ein frühes Beispiel von einfacher Medienkonvergenz. Um den Erdaufgang in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen, bedurfte es eines engen Zusammenspiels von Raumfahrttechnik, Kameratechnik, Übertragungstechnik und natürlich auch der gezielten Kooperation von Institutionen wie der NASA und den beteiligten Fernsehsendern.
Noch deutlicher wird das Zusammenspiel insbesondere der technologischen und der inhaltlichen Verschmelzungsdimension in dem Zeitraffervideo, das 24 Stunden Erdumdrehung digital in 24 Sekunden kondensiert. Das gleiche gilt für die 3000 Satellitenaufnahmen des Geosphere Project, die Tom Van Sant aus einem Aufnahmezeitraum von 3 Jahren zu einem ebenen Abbild der Erde zusammengeschmolzen hat.
Videos und Bilder wie diese erzeugen eine simulierte Realität, die in ihren Details durchgehend aus realen Abbildungen besteht. Das zeigt, wie die digitale Medienkonvergenz nicht nur neue Inhalte ermöglicht, sondern sogar semiotische Übergangsformen generiert, in denen Sein und Schein, Repräsentation und Konstruktion, Realität und Fiktion auf bisher ungekannte Weise miteinander konvergieren.
Begonnen aber hatte die Unbequeme Wahrheit – wie Sie sich erinnern – mit etwas ganz Anderem; nämlich mit der Musik von Michael Brook und kamerabewegten Bildern von den grünen Blättern eines Baumes, der an einem Fluss steht. Das ist der Caney Fork River, der durch das Farmland der elterlichen Ranch fließt, auf der Gore in Carthage/Tennessee aufgewachsen ist.6
Gore kommentiert die Musik und die Bilder mit den folgenden Worten aus dem Off: „Sie sehen wie der Fluss langsam an Ihnen vorbei fließt. Sie hören die Blätter wie sie im Wind rascheln. Sie hören die Vögel. Sie hören die Laubfrösche. In der Ferne hören sie eine Kuh. Sie spüren das Gras und den Schlamm am Ufer wie er nachgibt. Es ist still. Es ist friedlich. Und ganz plötzlich fühlen Sie wie Sie einen Gang runterschalten. Und es ist als würden Sie tief Luft holen und sich sagen: ‚O ja, das hatte ich ganz vergessen.“7
Gores fast schon dichterische Sätze lassen spürbar werden, was Giesecke meint, wenn er darauf hinweist, dass wir in unserer Medienkultur die kommunikative Dimension unseres Verhältnisses zu Pflanzen, Tieren und anderen Naturphänomenen (wie etwa Flüssen) zunehmend ausgeblendet haben.
Giesecke geht dabei sogar noch einen Schritt weiter als Gore. Medienökologisch besteht für ihn nämlich ein direkter Kausalzusammenhang zwischen dem Ausblenden der Natur und dem exponentiellen – fast schon krebsartigen - Wachstum der Mensch-Mensch- und der Mensch-Maschine-Kommunikation. Das Vergessen der Naturkommunikation und das Wuchern der Telekommunikation erscheinen ihm als zwei Seiten des gleichen Phänomens. Und zwar deshalb, weil Kommunikationszeit und Medienaufmerksamkeit knappe Ressourcen der Menschheit sind. Desto mehr Zeit und Energie wir in die Mensch-Mensch- und in die Mensch-Maschine-Interaktion investieren, umso weniger bleibt für die Mensch-Natur-Beziehung übrig.
Aber, wie gesagt, dass ist ein zusätzlicher Gedanke von Giesecke, der sich so nicht bei Al Gore findet. Wir können uns nachher in der Diskussion gern noch näher damit auseinandersetzen. Im aktuellen Zusammenhang ging es mir nur darum, Ihnen vor Augen zu führen, dass die Kommunikation mit Pflanzen, Tieren, Flüssen und der natürlichen Umwelt das Startmotiv von Gores Unbequemer Wahrheit ist. Darin kommt zum Ausdruck, was ich als Metakonvergenz von Mensch, Natur und Technik bezeichnet und von den einfachen Konvergenzformen unterschieden habe.
Gore und Giesecke stehen mit ihrer Wiederentdeckung der Natur nicht allein da. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen ein weiteres Videobeispiel zu zeigen. Dabei handelt es sich um ein weltweites Webseminar, das die berühmte amerikanische Moderatorin Oprah Winfrey im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem spirituellen Lehrer Eckhart Tolle durchgeführt hat. Im Zentrum ihres 10-teiligen audiovisuellen Internet-Syllabus stehen die 10 Kapitel von Tolles Buch Eine neue Erde (2005).
Die Sequenz, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, stammt aus der fünften Seminarsitzung.
Auch in diesem Video zeigt sich Medienkonvergenz in mehrfacher Hinsicht. Zum einen verschmelzen eine Reihe alter und neuer Medien zu der interaktiven und hochkonvergenten Form des audiovisuellen Webseminars. Dabei handelt es sich unter anderem um das orale Seminargespräch über ein Buch, die öffentliche Zitation eines Gedichts, die Form des TV-Talks und den damit vernetzten Gebrauch von Email und Skype.
Wir haben es hier also mit einer sehr weit entwickelten Form von einfacher Medienkonvergenz zu tun, die sich technisch, institutionell, inhaltlich und performativ beschreiben lässt. Zugleich aber ist offensichtlich, dass die zweite Art von Medienkonvergenz – also die Metakonvergenz von Mensch, Technik und Natur – in dem Webseminar ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.
Das zentrale Thema des von Oprah vorgelesenen Wagoner-Gedichts Lost ist die Kommunikation von Mensch und Wald: „If what a tree or a bush does is lost on you, you are surely lost. Stand still. The forest knows where you are. You must let it find you.“8 Dieses Zitat lässt sich 1:1 mit der Startsequenz von Gores Film in Beziehung setzen.
Und ähnlich wie Gores Fluss-Szene hat auch Oprahs Gedichtlesung eine sehr private Färbung. Für beide Personen spielt die intensive Naturerfahrung eine zentrale Rolle für die Entwicklung der inneren Potentiale ihres individuellen Selbst. Es geht dabei also um Selbstfindung, um Selbstvervollkommnung, um Vertiefung des eigenen Seinsgefühls.
Der zweite Teil der Seminarsequenz, in dem Tolle eine kollektive und telemediale Meditation über den „present moment“ leitet, hat noch eine weitere Komponente. Auch hier bezieht sich zwar jeder, der an diesem Meditationsritual teilnimmt, auf seine private Gegenwart. Aber indem dies viele Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam und sogar gleichzeitig tun, entsteht so etwas wie ein globales und kollektives Zeitbewusstsein.
Was eine solche televisionäre Zeitmeditation energetisch bedeutet, möchte ich hier offen lassen. In jedem Fall ist sie aber ein Beitrag dazu, ein Länder und Kontinente übergreifendes Zeitbewusstsein herzustellen. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes: als Bewusstsein von der Zeit als einem gemeinsamen Medium der individuellen Wahrnehmung von Selbst und Welt. Ich komme zum Schluss:
Wozu Medienkonvergenz?
Sie erinnern sich: die normative Hauptfrage meines Vortrags zielt auf den Nutzen und Nachteil von Medienkonvergenz für das menschliche Zusammenleben. Ich denke, dass es nach den bisherigen Ausführungen über Pragmatismus und Medienökologie sowie über den Unterschied zwischen einfacher und höherstufiger Medienkonvergenz nun etwas leichter fällt, einen Antwortrahmen zu skizzieren. Das möchte ich in meinen abschließenden Überlegungen jetzt tun.
Dabei erscheint es mir hilfreich, auf die beiden pragmatischen Nützlichkeitskriterien zurückzugreifen, die ich Ihnen im zweiten Vortragsteil anhand von Rortys Neopragmatismus vorgestellt habe. Beide Kriterien beziehen sich auf Ideale, Ziele und Hoffnungen, die sich in den demokratischen Gesellschaften der modernen Nationalstaaten in den letzten beiden Jahrhunderten herausgebildet haben. Insofern kann man auch - statt von pragmatischen Nützlichkeitskriterien - einfacher und deutlicher von unseren demokratischen Utopien reden.
Die erste dieser beiden Utopien bezieht sich auf die private Selbstverkommnung. Sie besteht in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen in demokratischen Gesellschaften in die Lage kommen, ihre eigenen Potentiale zu entfalten und in ihrer Freizeit den eigenen Phantasien, Spleens und Hobbys möglichst ungestört nachzugehen ohne dabei andere Menschen zu verletzen. Wünsche und Ziele dieser privaten Art lassen sich realisieren, wenn es gelingt, die eigenen Handlungsgewohnheiten gut aufeinander abzustimmen, so dass daraus ein stabiles Selbst, ein glückliches Privatleben entsteht.
Die zweite demokratische Utopie unterscheidet sich von der ersten vor allem dadurch, dass sie einen dezidiert öffentlichen und unmittelbar politischen Charakter hat. Die mit ihr verbundenen Ideale und Hoffnungen zielen auf die Verringerung von Demütigung und Grausamkeit sowie auf die Vermehrung von Solidarität in den zwischenmenschlichen und zwischenstaatlichen Beziehungen der Welt, in der wir leben.
Die Ziele dieser zweiten Utopie sind im Unterschied zu den Zielen der ersten nicht Privatsache, sondern bedürfen der kollektiven Zusammenarbeit. Denn hier geht es nicht um die interne Selbstkohärenz, sondern um die politische Abstimmung der eigenen Handlungsgewohnheiten mit den Gewohnheiten anderer Individuen, Gruppen, Städte, Regionen, Nationen, Kontinente etc.
Beide Sorten von Konvergenz – sowohl die einfache von Techniken, Institutionen, Inhalten und Nutzungsgewohnheiten als auch die höherstufige von Mensch, Natur und Technik – können nun als Instrumente dienen, um die beiden soeben beschriebenen demokratischen Utopien zu sichern und voranzutreiben. Mehr noch: Sie können sich dabei sogar wechselseitig unterstützen.
Ein gutes Beispiel dafür bringt Al Gore in seinem vor wenigen Tagen erschienenen Buch Our Choice (dt. Ausgabe: Wir haben die Wahl). Das Beispiel zeigt, wie die intelligente Nutzung von technisch-institutioneller und inhaltlich-performativer Medienkonvergenz zur Wiederherstellung eines verantwortungsvollen Naturverhältnisses beitragen kann. Ich zitiere Gore:
„Wie wäre es, wenn wir 24 Stunden am Tag live eine hochauflösende Farbaufnahme von der im Weltall kreisenden Erde empfangen könnten? Wenn ein Satellit mit einer Fernsehkamera in eineinhalb Millionen Kilometern Entfernung zwischen ihr und der Sonne kreiste, so dass sie dabei ständig angestrahlt würde? Was, wenn dieser Satellit zugleich mit Spezialinstrumenten die Gesamtmenge an Energie messen könnte, die die Sonne zur Erde schickt, und diese Menge in Echtzeit mit der vergliche, die von der Erde in den Raum zurückgestrahlt wird? Der Unterschied zwischen diesen beiden Messergebnissen ist deshalb so wichtig, weil er ein exaktes Maß zur Berechnung der Erderwärmung liefert.“9
Tatsächlich denke ich, dass die Bekämpfung des Klimawandels derzeit auf dem besten Weg ist, sich zusammen mit dem ebenso wichtigen Ziel einer Globalisierung demokratischer Politik zum zentralen Bestandteil der öffentlichen Utopie moderner Mediendemokratien zu entwickeln. Wenn wir glauben, Medienkonvergenz sei ein Phänomen sui generis und nicht in erster Linie etwas, das wir für unsere demokratischen Zwecke nutzen können, verpassen wir eine großartige Chance, die der aktuelle Medienwandel bietet.
Sicherlich, in einigen Bereichen der Medien- und Kommunikationswissenschaft wird Medienkonvergenz als eine technoökonomische und/oder soziosymbolische Eigendynamik von geschlossenen Systemen verstanden, der gegenüber wir uns nur passiv als Beobachter verhalten können. An die Stelle der demokratischen Utopien, für die sich Rorty und der Pragmatismus stark machen, treten in diesem Kontext dann ökonomische und technologische Imperative.
Selbstverständlich lässt sich auch aus diesen Imperativen eine Antwort auf die Frage „Wozu Medienkonvergenz?“ entwickeln. Der Grundtenor lautet dann: Medienkonvergenz dient dazu, die Werbungsformen zu optimieren und Medien via Werbung als weltweite, interaktive und hochkonvergente Wachstumsgeneratoren einzusetzen. Das wäre dann sozusagen das medienkonvergenztheoretische Update zu der folgenden, noch auf der Fernsehlogik basierenden Darstellung der amerikanischen Stadtplanerin Annie Leonard.
Die von Leonard polemisch betrachtete Art von Werbung zielt auf die Privatsphäre der als Konsumenten verstandenen Menschen. Dementsprechend werden die von der Werbung weltweit getriggerten ökonomischen Wachstumsprogramme zumeist durch den Rekurs auf die erste der beiden demokratischen Utopien legitimiert: Konsum als Instrument der Selbstverwirklichung.
Das Problem ist nur, dass diese Art von Konsum zunehmend auf Kosten der Selbstverwirklichungsmöglichkeiten nicht nur von anderen Menschen, sondern auch von anderen Lebewesen und sogar auf Kosten der Lebensbedingungen unseres Planeten geschieht.
Vor diesem Hintergrund erscheint mir gerade der Wechselbezug, der sich herstellen lässt zwischen der höherstufigen Form von Medienkonvergenz und der privaten Utopie unserer demokratischen Lebensgewohnheiten von besonderer Wichtigkeit. Desto mehr Menschen die Gelegenheit erhalten, die Vervollkommnung ihrer selbst im Wechselspiel mit den Energien von Pflanzen, Tieren und Flüssen zu erfahren, umso bewusster können die Konsumentscheidungen der Menschheit in Zukunft ausfallen.
Vor einigen Wochen habe ich im Spiegel einen Bericht über „Neuro-Enhancement“ gelesen.10 Darin ging es unter anderem um den Sachverhalt, dass immer mehr SchülerInnen und Studierende Ritalin, Concerta oder Vigil – also Medikamente, die Methylphenidat, Amphetamin oder Modafinil enthalten - dazu nutzen, um ihre Gehirnleistungen und ihren IQ zu optimieren. Schon vor vier Jahren kam laut Spiegel eine amerikanische Studie zu dem Ergebnis, dass vier Prozent der Studierenden in den USA diese Mittel regelmäßig einnehmen.
Auch hier geht es um Konvergenz. Und zwar um die Konvergenz zwischen Computer und Gehirn. In der digitalen Wissensgesellschaft sind die Leistungsansprüche an Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Lernfähigkeit und Assoziationspotential derart gestiegen, dass die Menschen selbst ihren internen Computer – also ihr eigenes Verarbeitungsmedium Gehirn – updaten müssen, um mit den technischen Medien noch konvergieren zu können. Die Nebenwirkungen stehen auf dem Beilagenzettel: Schlafstörungen, Herzbeschwerden, Psychosen.
Aber auch hier gilt, was der Titel von Al Gores neuem Buch nahe legt: „Wir haben die Wahl“! Genau - wir können das Update verweigern. Und besser noch: wir können nach natürlichen Methoden Ausschau halten, die uns helfen unsere Urteilskraft, unsere Erdung, unsere emotionale Intelligenz und Empathie zu stärken. Statt Ritalin vielleicht ein wenig Yoga? Statt Concerta body based learning mit Moshe Feldenkrais? Statt Vigil eine Runde Capoeira oder Aikido? Wir leben in einer vernetzten Welt, in der auch die edukativen Praktiken global konvergieren. Zum Glück! Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
[1] Ankündigungstext der Ringvorlesung „Medienkonvergenz und Neue Medien“, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Medienwissenschaft, WS 2009/2010.
[2] Ankündigungstext zur Ringvorlesung „Medienkonvergenz und Neue Medien“, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Medienwissenschaft, WS 2009/2010.
[3] Vgl. Ankündigungstext der Ringvorlesung „Medienkonvergenz und Neue Medien“, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Medienwissenschaft, WS 2009/2010.
[4] Richard Rorty, „Kulturpolitik und die Frage der Existenz Gottes“, in: ders.: Philosophie als Kulturpolitik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, S. 21.
[5] Michael Giesecke: Die Entdeckung der kommunikativen Welt. Studien zur kulturvergleichenden Mediengeschichte, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2007, S. 263.
[6] Vgl. hierzu Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit. Eine globale Warnung, München: Riemann 2006, S. 122.
[7] Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit. Der Film, Kapitel 1: „Der Fluss“, 2006.
[8] David Wagoner, „Lost“, in: ders., Travelling Light: Collected and New Poems, Champaign: University of Illinois Press 1999, p. ##. (zitiert nach: http://www.seishindo.org/david_wagoner.html)
[9] Al Gore, Wir haben die Wahl. Ein Plan zur Lösung der Klimakrise, München: Riemann 2009, S. 374.
[10] „Wow, was für ein Gefühl!“, in: Der Spiegel, Nr. 44, 26. Oktober 2009, S. 46ff.