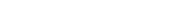erschienen in: der blaue reiter. Journal für Philosophie, Nr. 13, Heft 1/2001, S. 60-67.
Interview von Klaus Erlach, Udo Grün und Siegfried Reusch
Wir haben noch jedes Medium niedergerockt.
Ein Interview mit Friedrich Küppersbusch und Mike Sandbothe
BR: Herr Küppersbusch, Sie sind als Moderator und Interviewer bekannt geworden. Was sind die Grundpfeiler Ihrer Medienphilosophie?
Küppersbusch: Das Stattfindenlassen von möglichst vielen Informationen, Meinungen und Menschen.
BR: Was heißt Stattfindenlassen?
Küppersbusch: Im Idealfall heißt es, die Eigendynamik der Medien, ob das Printmedien, Radio, Fernsehen oder Internet sind, so weit zurückzudrängen, dass ein Stück Authentizität sichtbar, hörbar, lesbar, wahrnehmbar wird. Und da ist es eben nötig, sich mit der Eigendynamik der Medien professionell auseinander zu setzen. Ganz wichtig für mich war die erste Fernsehsendung, die wir produziert haben: eine Jugendgesprächsreihe. Damals störte uns, dass eigentlich alle Gesprächssendungen Rhetorikwettbewerbe sind, wo unabhängig vom vertretenen Inhalt oder Anliegen immer der gewinnt, der die Kampfsportart Medienrhetorik am besten beherrscht. Es gibt ja im politischen Geschäft ein paar ganz austrainierte Spitzenkämpfer, wo man im Prinzip weiß, der WrestlingAspekt an so einer Gesprächssendung wird dominieren. Du brauchst ein Mantra, das Mantra muss sehr einfach sein, und du musst es, unter Missachtung deiner eigenen Intelligenz wiederholen; an der Stelle, wo es dir selber schon richtig gut auf die Nerven geht, musst du weitermachen und dir das Publikum immer noch ein bisschen dümmer denken. Und da haben wir eine Sendung erfunden, wo vier Diskutanten eingeladen waren und die Rolle des Moderators aufgelöst war. Jeder Diskutant bekam fünf Minuten, hatte eine Uhr.
BR: Wie beim Schach.
Küppersbusch: Genau. Jeder konnte zehn Statements abgeben oder fünf Minuten am Stück quatschen oder er konnte warten, bis die anderen sich leer geredet hatten, und dann sagen, okay, ich bin rhetorisch schlecht zu Fuß, aber jetzt müsst ihr mir fünf Minuten zuhören. Theoretisch verbildet und akademisch blauäugig wie wir waren, dachten wir, dass wir der jungen Menschheit etwas Tolles schenken, einen Fleck der Authentizität. Am Ende waren wir nur noch am Casten, das heißt wir suchten und testeten ununterbrochen neue Gesprächspartner. Und das ist das Gegenteil sowohl von Mündigkeit als auch von Demokratie, es ist einfach eine Elitenauswahl.
BR: Inwieweit ist es überhaupt möglich, Authentizität zu vermitteln?
Küppersbusch: Wir haben in Deutschland eine sehr schwierige Ahnengalerie, was den Journalismus angeht. Nicht aus eigener Kraft, sondern als wohlmeinende Medizin haben wir, nach der Gleichschaltung der Medien 33 bis 45, das Nachrichtenideal der BBC bekommen. Der britische Nachrichtensprecher war ein Neutrum. Bis in die 70er Jahre war für die Hörfunknachrichtensprecher der BBC vertraglich vereinbart, dass sie vor dem Mikrofon Frack und Krawatte zu tragen hatten, obwohl die Zuhörer die Sprecher beim Radio nicht sehen. Ich denke, das muss den Deutschen, nach dem, was sie zusammen mit Goebbels Schönes hinbekommen haben, auch sehr eingeleuchtet haben, dieses Ideal des extremen Neutrums am Mikrofon. Es ist nur nicht wahr. Die Authentizität entsteht nicht dann, wenn der Journalist der Fiktion anhängt, er könne sich verschwinden machen, sondern sie entsteht dann, wenn er in einer gewissen Weise erkennbar ist und damit auch als Subjekt des Handelns für den Betrachter oder den Zuhörer oder den Leser erkennbar ist.
BR: Soll er nicht Medium werden für das, worüber er berichtet?
Küppersbusch: Nein. Er soll Katalysator sein oder eine Bande am Billardtisch. Es ist nicht möglich, ein Interview zu führen oder eine journalistische Leistung zu vollbringen, ohne dass Sie darin in irgendeiner Weise als Interviewer statt finden. Authentizität entsteht, wenn man kein gemeinsames Rollenspiel vorführt. Ich bin kein Fieberthermometer und der Interviewpartner ist kein Zigarettenautomat erbaulicher O-Töne. Auch der hat ja Absichten und Interessen und blinde Flecken, Dinge, die er sagen möchte, und Dinge, die er nicht sagen möchte. Man kann eigentlich nur immer in sich selber rumloten und sich fragen: Was genau will ich eigentlich von dem Mann wissen? Und dann ist es letztlich Inshallah, wenn Sie mittigster Mainstream ihres eigenen Publikums sind.
BR: Welcher Punkt ist es, an dem Sie über das, was gewöhnlicherweise geboten wird, hinausgehen können?
Küppersbusch: Ich kann Fernsehen machen, indem ich ganz tolle Quoten und damit Erfolg habe und mir sagen: Das ist sinnvoll. Aber eigentlich ist es nur ein Methadonprogramm für Sinn. Mit Ihrer Suche nach Sinn stehen Sie ziemlich alleine in der Gegend herum. Wo soll der herkommen? Letztlich stifte ich den Sinn. Ich verlange auch nicht nach der Ersatzreligion Philosophie - gib mir den Sinn, den ich in meinem Schaffen irgendwie nicht entdecke -, weil dieser rein aufklärerische, basisdemokratische Ansatz in Anbetracht der Apparate naiv ist. Ich kann nicht richtig gut Quotenfernsehen machen und letzten Endes ist es auch nicht steuerbar, immer dann, wenn man wegen schlechter Quoten abgesetzt werden soll, noch schnell einen Fernsehpreis zu kriegen, damit man noch mal weitermachen darf. Mein Trost kann nur sein: Ich habe eine Linie in dem gesehen, was ich da gemacht habe. Der Sinn, von dem erwarte ich natürlich, dass er mich einschließt, dass er nicht auf Kosten, sondern zu Nutzen anderer und zu Nutzen einer Gemeinschaft geht.
BR: War das der Sinn Ihrer Sendung „Privatfernsehen"? War es nicht auch der Versuch zu entlarven?
Küppersbusch: Ich bin in kein einziges Interview gegangen mit der Absicht, jemanden bloßzustellen. Ich bin sicherlich auch eitel und möchte nicht untergebuttert werden. Es schmeichelt auch, wenn man als besonders unnachgiebiger Journalist angesehen wird. Aber ich habe es nicht darauf angelegt. Mein Ehrgeiz war, mit diesen Leuten ein Gespräch zu führen. Und man muss schon massiv an die Tabugrenzen dieses Rituals knallen, auch darüber hinweggehen, um ganz deutlich dem Gegenüber und dem Publikum zu sagen: Das hier ist jetzt kein Ritual; es ist keine Frage abgesprochen, es ist kein Thema abgesprochen. Ich interessiere mich jetzt für dieses Gegenüber nicht nur als O-Ton-Spender, sondern ich will wissen: Was denkst du Verteidigungsminister - oder Menschlein, das im Verteidigungsminister ja immer noch wohnt - darüber, was du da eigentlich gemacht hast? Wie kommt das dazu, dass du unter dem Spitzentarif „Milosevic ist Hitler" gar nicht in der Lage bist, dein eigenes kriegerisches Handeln zu begründen? Warum sagst du mir einerseits: Das ist ein Menschenrechtskrieg und erklärst mir und für viele Menschen plausibel, dass zum Schutz und zur Erhaltung der Menschenrechte im Kosovo Krieg gemacht werden muss? Warum brauchst du jetzt eine Projektion, die mindestens kz heißt, um vor dir selber dein Tun zu begründen? Das sind Fragen, die richten sich an den Menschen, und schon an dieser Stelle sind Sie im Prinzip aus dem klassischen Ritual „politischer Journalist interviewt Verteidigungsminister" raus. Ein Teil der Fachöffentlichkeit rappelt dann gleich am Tisch, weil es dafür noch keine Schublade gibt. Dann wird die neue Schublade „irgendwie respektlos, tabuverletzend oder auch quotengeil" aufgemacht. Aus dieser Schublade kam ich nicht mehr raus, das war mein Problem. Ab einem bestimmten Punkt finden Sie es so geil, dass Sie jetzt der elektronische Robin Hood sind, dass Sie Gefahr laufen, sich selbst zu reproduzieren. Dann müssen Sie aufhören, wenn Sie Glück haben; oder rausfliegen, wenn Sie Glück haben. Eine Mischung von beidem habe ich ja gehabt.
BR: Herr Sandbothe, haben die neuen Medien wie das Internet überhaupt den Anspruch, Wirklichkeit zu repräsentieren?
Sandbothe: Das, was gerade beschrieben wurde, ist ja ein durchaus unorthodoxes Verständnis von Fernsehpraxis. Darin liegt ein spannendes Zukunftspotenzial. Es geht um die Frage, wie die Medienkonkurrenz des Internets das Fernsehen in Zukunft verändern könnte. Schaut euch an, dass man von verschiedenen Medien unterschiedlichen Gebrauch machen kann. Den Gebrauch vom Medium Fernsehen, den Friedrich jetzt gerade beschrieben hat, würde ich als eine pragmatische Form der Nutzung dieses Mediums verstehen: Das, was wichtig ist, um Authentizität zu erzeugen, ist nicht die exakte Abbildung oder Konstruktion von Wirklichkeit, sondern die Haltung des Moderators und die Hoffnung auf eine korrespondierende Haltung beim Gesprächspartner; ein Interesse an Veränderung von Wirklichkeit. Das ist etwas anderes, als dieser theoretische Anspruch der klassischen Fernsehtradition, Wirklichkeit abzubilden. Damit kann man die spannende Praxis, die Friedrich beschrieben hat, gar nicht fassen. Auch die Debatte zwischen Konstruktivismus und Realismus ist sozusagen eine Debatte um verschiedene Interpretationen von Neutralität. Neutralität kann sich ergeben dadurch, dass ich zum Spiegel werde, in dem sich Wirklichkeit spiegelt. Neutralität kann aber auch verstanden werden als Konstruktion eines Sachverhalts nach intern vorgegebenen Regeln eines Mediums - das wäre etwa die Luhmann'sche Interpretation: Ich folge den Regeln, die das System vorgibt, und dadurch erzeuge ich Information - nicht in der Abbildung von Wirklichkeit, sondern in der Logik vorgegebener Regeln für die Konstruktion von Wirklichkeit. Kurz: Nach Luhmann kann es Küppersbusch nicht geben. Natürlich muss man die Regeln kennen, um innerhalb der Logik des Systems Veränderungsmöglichkeiten auszuloten, aber man muss sich auf sich selbst auch ein Stück weit verlassen als Bürger, der in Handlungskontexten politische Wirklichkeit erfährt, der ein Gefühl dafür hat und auf seine Intuitionen als Mensch vertraut. Und der Mut zu dieser Subjektivität könnte, denke ich, die Grundlage einer pragmatischen Neuorientierung des Fernsehens im Zeitalter des Internets sein. Insofern würde ich auch die beiden Medien nicht gegeneinander ausspielen. Wir sollten dieselbe Diskussion auf der Ebene des Internets auch führen. Wie nutzen wir das Medium Internet intelligent?
Küppersbusch: Das ist für Fernsehschaffende, die aus akademischer Sicht Outlaws sind, sich mit trivialen Dingen befassen und ihre ja in der Regel akademische Vorbildung zu höchst banalem Kirmestreiben missbrauchen, ein trostvolles Wort, wenn aus dem akademischen Kontext oder Diskurs die Nachricht kommt: Es gibt auch bei uns Schulen, die in erster Linie und zunächst einmal auf den Menschen und sein Selbstvertrauen, auf seinen Menschenverstand setzen. Sie müssen, wie ich finde, einen sehr banalen Faktor mitbetrachten: Die Medienbranche ist bis zum Anschlag voll mit Studierten, Teilstudierten, Studienabbrechern... Die kommen alle in diesen Apparat und lernen goldende Regeln wie: „Um 18 Uhr muss alles passiert sein." Oder: „Bist du auch noch so fleißig, nichts geht über 1.30." Dann kommt noch Herr Postman und sagt, dass wir letzten Endes an einer Totschlagshandlung beteiligt sind - wir amüsieren die Leute zu Tode; wir helfen ihnen dabei, intellektuellen Selbstmord zu verüben. Und dann entsteht etwas ganz Bizarres, Rührendes, wie ich finde: Auch die schlimmste Dreckszeitung oder das übelste Schweinemagazin spricht von seiner Redaktionsphilosophie oder von der Philosophie in den Beiträgen. ProSieben, die Kirchgruppe, spricht von ihrer Senderphilosophie. Ich komme aus einer Welt, in der jede Kabelhilfe seine Kabelhilfen-Philosophie hat. Es gibt eine Inflation von Philosophien aus Mangel an Philosophie.
Sandbothe: Es gibt sehr viele Parallelen zwischen akademischem Unterricht und der Art und Weise, wie Fernsehen gemacht wird. In deutschen Massenuniversitäten finden wir immer häufiger eine Anlehnung an Showszenarien. Auch Seminare in der Philosophie werden zur Show nach dem Motto: Je mehr Publikum, umso besser die Veranstaltung. Das einfache Gegenmantra lautet: Nicht das meiste, sondern das beste Publikum zeichnet eine Veranstaltung aus. Mit diesem Mantra sammelt übrigens n-tv Werbeeinnahmen!
BR: Ist es überhaupt Aufgabe des Fernsehens, die Bevölkerung zu bilden, oder geht es nicht vielmehr darum, die Zuschauer einfach nur zu unterhalten?
Sandbothe: Ich denke, das sind normative Entscheidungen. Es gibt verantwortungslose Theoretiker, die Politikern erklären: Das ist die Logik des Mediums! Fertig, aus. So findet ja ein Großteil der aktuellen Multimediapolitik in Deutschland statt. Entweder heißt es: Das ist der Horror, ein Tabu; so hat ja die SPD zunächst auf die neuen Medien reagiert. Oder aber, wenn es nicht als Horror gilt, dann ist es Schicksal, und wir unterwerfen uns der kommerziellen Spaßmaschine. Dass das politisch gestaltbar ist, ist bis heute noch vielen Politikern gar nicht klar.
Küppersbusch: Mike sagt, dass der technische Apparat, der Fernseher oder der online-vernetzte Personalcomputer, ja gar nichts will; der hat keine Gesetze, der ist von Menschen mit dem Blick auf gewisse technische und auch wahrnehmungspsychologische Gesetze konstruiert worden. Ich neige dazu, dass das Fernsehen von seinen Erfindern und seinen Entwicklern als Reizdusche entwickelt worden ist. Insofern bin ich nicht so weit weg von den typischen kulturpessimistischen Kritikern, wonach Fernsehen eigentlich so funktioniert wie das gute alte Lagerfeuer unserer Ahnen: Da gibt es eine Untergrenze, bei der die Menschen nervös werden, weil das Feuer auszugehen droht. Es gibt in diesem Knistern des brennenden Materials auch eine Obergrenze, weil dieses Knistern vielleicht nicht von verbrennendem Harz in den Ästchen herkommt, sondern vom Tritt des sich anschleichenden Säbelzahntigers. Und das hat dieser Neandertaler beeindruckend auf das elektronische Lagerfeuer übertragen: Es gibt eine Untergrenze, wo es zu langweilig wird - da wird er zappelig und fängt an zu zappen. Und es gibt eine Obergrenze, wo Omi sagt: MTV will ich nicht gucken. Da schleicht sich für Omi der überlebte Säbelzahntiger aus dem Unterholz an. Deswegen kann man erfolgreich Fernsehen machen, wenn man sich geschickt in dem Toleranzband bewegt und immer ein bisschen an die Obergrenze klatscht und sagt: „Hallo, hallo, nicht einschlafen, das ist was Besonderes hier!" Und indem man bewusst die Untergrenze bestreicht und sagt: „Keine Angst, hier ist das ganz gemütliche Fernsehen, hier gibt es Volksmusik und lange Gespräche.“ Damit ist ein gewisser Zynismus in der Haltung gegenüber der wahrnehmungspsychologischen Wirkungsweise dieses Mediums schon da. Ich will keinen Wissenschafts-TÜV für Fernsehsendungen haben, die weder Quote noch Fernsehpreise haben, damit die dann mit dem Wissenschaftssiegel weiter senden dürfen. Aber ich will Handreichungen von der Wissenschaft haben. Das ist banal. Ich bezahle Steuern, aus denen diese Hochschulen leben. Und jeder, der Umwälzpumpen herstellt, der geht an die Rheinisch-Westfälische Technische Universität und sagt: Jetzt forscht mal bitte. Ich möchte wissen, wie ich meine Umwälzpumpen besser herstellen kann.
BR: Herr Sandbothe, wie macht man eine gute Sendung? Und wie bekommt man viele Zuschauer für diese Sendung?
Sandbothe: Wir arbeiten daran. Gelächter
Sandbothe: Aber vielleicht zu Friedrichs Diagnose. Das hat natürlich auch zu tun mit der spezifischen europäischen Wissenschaftskultur. Wenn wir etwa Silbermanns Kritik an der Publizistikwissenschaft im Blick haben, geht es in dieser empirischen Wissenschaft vor allem um die Erkenntnis von Vergangenheit. Das ist das alte aristotelische Grundproblem: Wahre Aussagen kann ich nur über Prozesse machen, die bereits vergangen sind. Über die Zukunft muss ich normativ reden. Das ist die Grundlage der aristotelischen Ethik. Theoretische und praktische Diskurse sind zwei ganz unterschiedliche Ordnungen des Denkens. Normatives, auf Zukunftsgestaltung ausgerichtetes Denken, zielt auf die Frage: Was wollen wir? Das ist genuin politisch, nicht theoretisch, orientiert. Aber Wissenschaft in Deutschland tendiert dazu, den theoretischen Diskurs zu verabsolutieren. Sie ist fixiert auf Wahrheit als das heilige Gut, das uns noch geblieben ist - statt zugleich darüber zu diskutieren: Wie wollen wir Medien gestalten? Dieses pragmatische Bewusstsein fehlt. Ich bin sehr dafür, dass Medien, Wissenschaft und Politik lernen, enger miteinander zu kooperieren. Es gibt die Kooperation der Theoretiker in Medien, Wissenschaft und Politik. Diese Leute denken in den Logiken der Hypes, der Themenkarrieren, deren Hauptaufgabe es ist, die politisch brisanten Themen zu kaschieren, wo es wichtig wäre, gemeinsam Antworten zu finden. Die Theoretiker lancieren Themen, auf die es schon Antworten gibt und diskutieren Pseudofragen. Die kollektive Intelligenz all der Systeme, die wir haben, und auch der Bürgerinnen und Bürger, die nachher damit leben müssen, wird so nicht genutzt, weil die wirklich wichtigen Diskussionen im stillen Kämmerlein stattfinden. Und es gibt eine zweite Form der Kooperation von Medien, Wissenschaft und Politik, die diese Probleme thematisiert und die normative Frage stellt: Wie wollen wir leben? - Das ist die Frage, die gestellt werden sollte. Diese Art einer im anspruchsvollen Sinn pragmatischen Kooperation müssen wir erst noch etablieren. Natürlich gehört zu einer guten Wissenschaft beides: Sie ist einerseits Zur-Verfügung-Stellung von selbstzweckhaft entwickelten theoretischen Gedankenblüten und andererseits die Beschäftigung mit der Frage, welche Theorien man nutzt, um demokratische Gesellschaften für alle Menschen befriedigender, gerechter, besser zu gestalten. Ein Grundgedanke der pragmatischen Medienphilosophie, an der ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, ist das Plädoyer dafür, die fast schon religiöse Debatte über Konstruktivismus und Realismus, die die medienwissenschaftliche Diskussion in Deutschland sehr stark prägt, ein wenig zu relativieren. Es gibt zu viel theoretische und zu wenig praktische Philosophie in den Medienwissenschaften. Es geht um die Frage: Welche Medienwissenschaft ist für demokratische Gesellschaften angemessen? Ich plädiere dafür, weniger zu fragen: „Wie ist die Wirklichkeit eigentlich in Wirklichkeit?" und mehr zu thematisieren: „Wie wirken Medien auf die Veränderung von Grundhaltungen im Umgang mit Wirklichkeit ein?" Wir brauchen Leute, die sich ein bisschen mehr auf die scheinbar banalen Probleme richten und sich die Frage stellen, welche Theorie eigentlich spannend für die Gestaltung einer demokratischen Medienpraxis ist. Medienphilosophischer Pragmatismus bedeutet, die quasi religiösen Rituale der massenmedialen Aufmerksamkeitskulte durch eine antiautoritäre, sachbezogene, offene Kultur der Diskussion zu durchbrechen. In dem von Friedrich produzierten TV-Format Maischberger geht es zum Beispiel auch darum, Menschen, die in Funktionen handeln, in einer minimalistischen Situation, in einem intimen Studio zu fragen, wie sie eigentlich als Mensch zu dem, was sie da tun, stehen. Natürlich stehen diese Ideen in der Tradition der Aufklärung; das ist auch gut so. Kant steht den elektronischen Massenmedien erst noch bevor, n-tv ist doch ein gutes Beispiel dafür, während die öffentlich-rechtlichen Sender immer kommerzieller werden.
Küppersbusch: Wenn wir in diesem Kreis vor zehn Jahren zwei Videokassetten gesehen hätten, eine Sendung von Jürgen Fliege und eine Sendung von Sandra Maischberger, dann würde ich mal auf 5:0 dafür tippen, dass wir gesagt hätten, die Maischberger wird im Jahr 2001 bei der ARD laufen und der Fliege bei RTL oder irgendeinem Kommerzsender. Auch bei Fernsehformaten wie Big Brother muss man erst mal tabulos draufgucken und nicht schon „Huch!" sagen. Die Bereitschaft der Preisgabe von Intimität hat im Netz eine ganz andere Kultur als im Radio oder Fernsehen. Und ich bin nicht bereit, bevor ich mir das nicht zu Ende überlegt habe, Big Brother schlecht zu finden. Ich bin zufrieden damit, dass es eine in jeder Hinsicht ausgeprägte Big-Brother-Staffel gegeben hat. Ich glaube, dass da alles zu erkennen war. Und genauso gilt es auch, das Netz vor allen Dingen erst mal stattfinden zu lassen. Und vor dem Netz ein Publikum entstehen zu lassen, das ganz neue Ansprüche an mein Altmedium formulieren wird. Ich bin sicher, dass durch das Internet ein Teilpublikum entsteht, das sich einfach nicht mehr widerspruchslos eine Stunde lang von Herrn Schröder bei „Christiansen" erklären lässt, wie die Welt funktioniert.
BR: Wie verändern Medien die Selbstwahrnehmung? Hat Big Brother einen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der Menschen?
Küppersbusch: Wir haben ja drolligerweise in dem Moment, in dem Big Brother und das „Inselduell" und was da noch alles kam, ihren Erfolg begannen, einen dramatischen Niedergang in den Daily-Talk-Formaten. Beim Daily Talk funktionieren quotenmäßig die Themen, die auch beim Tratsch im Treppenhaus funktionieren: Die Jüngste vom Hausmeister hat ein „Piercing", die allein stehende Studentin hat Herrenbesuch, bei den Müllers in der zweiten Etage ist die Ehe nicht zum Besten... Hingegen: Die Wiederherstellung der Parität in der sozialen Rentenversicherung ist nicht sicher - das funktioniert im Treppenhaus nicht und funktioniert auch garantiert in dieser Sendung nicht. Es wird heute nicht der Marktplatz, sondern der Hausflur in ein Fernsehformat übersetzt. Jetzt ist mit Big Brother die Haustür überwunden, und wir müssen nicht mehr teilnehmen, wie Leute über das Mutmaßungen oder Wissen austauschen, was hinter der Schlafzimmertür stattfindet, sondern wir sind auch da. Das muss ich aber erst mal wertfrei zur Kenntnis nehmen, bevor ich es beurteile.
Sandbothe: Aber es gelingt nicht immer. Offensichtlich haben ja diejenigen Medienwissenschaftler, die dann die anderen Sender beraten haben, diese Sendung mit Girlscamp und so weiter zu doubeln, diesen Punkt nicht entdeckt. In der eigenen Logik des Systems, und zwar der Logik des Starkults, wurde versucht, das Ganze nachzuspielen, aber nicht entdeckt, was die eigentliche Faszination war. Big Brother ist ein Versuch der Nachahmung der interaktiven Kultur des Internets durch die Beteiligung des Zuschauers am Fernsehen. „Wir sind wichtig, wir haben etwas zu sagen" - nicht nur via E-Mail, sondern auch im Fernsehen. Die Faszination für viele Zuschauerinnen und Zuschauer lag ebendann, dass da Menschen wie sie selbst im TV-Container waren. Das war jedenfalls am Anfang so in Big Brother; man merkte, wie wichtig die eigenen kleinen Probleme sind. Da gibt es nicht nur die Verona Feldbuschs, nicht nur die Boris Beckers, nicht nur die Starkult-Leute, die nur deshalb wichtig sind, weil sie schon mal wichtig waren.
BR: Stört es Sie nicht, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Leute in den Containern zu sein glauben, und dem, was sie sind?
Küppersbusch: Aber das ist doch gerade das Wunderbare; dass in der Bravo besprochen wurde: Die Tina - sagen wir mal -, die spielt uns was vor. Tina war ein Vierteljahr und 24 Stunden am Tag über Webcam zu beobachten, und es gab jetzt eine Diskussion darüber, inwieweit das authentisch ist. Tragen Sie mal eine Debatte über Authentizität in den Medien mit den Mitteln der klassischen Medientheorie oder Philosophie in die Bravo - da drücke ich Ihnen die Daumen. Das fand ich eine höchst segensreiche Auseinandersetzung, vor allen Dingen, wenn man überlegt, welche Zielgruppen mit dieser Frage konfrontiert wurden. Im übrigen, wenn sie letztes Jahr diese CDU-Krise nehmen, da war ganz schnell die Rede vom Vatermord; dann kam die Frage auf, ob die Tochter die Nachfolge erbringen kann; dann gab es den verkrüppelten Onkel und die Frage, ob der das kann; dann gab es eine Reihe von Vettern... Solange für mich nicht bewiesen ist, dass Politik nicht nach unterbewussten oder vorbewussten Schemata konsumiert und entschieden wird, die viel mehr mit Big Brother zu tun haben als mit der Frage, wie die Pflegeversicherung zu finanzieren ist, so lange muss man mit dieser Debatte viel vorsichtiger umgehen und erst mal gucken. Das Gerangel an der Spitze der Union letztes Jahr entsprach einer Menge formaler Kriterien von Big Brother. Einschließlich der Tatsache, dass wir in zwei Jahren die Publikumsstimme abgeben werden.
BR: Das Fernsehen scheint einiges bewirken zu können. Hatten Sie diesen Eindruck öfter in den letzten Jahren?
Küppersbusch: Zunächst kehren wir ja mit dem Modell der CDU-Krise oder Big Brother zu etwas zurück, was wir meinen, als aufgeklärte Mitteleuropäer mit der Zeit der Fürstenhöfe hinter uns gelassen zu haben: dass die Geschicke ganzer Völker, Kriege, Niederlagen, Siege, Fusionen von Staaten..., praktisch durch das Zusammenwirken einer Familie oder einer Sippe entschieden werden. Heute gibt es viel mehr von allem. Es gibt viel mehr schlechtes Fernsehen, es gibt aber auch viel mehr Qualitätsfernsehen als früher. Wenn Sie achtzig sind, werden Sie sich leuchtend an Ihre ersten 20 Lebensjahre erinnern, und alles Weitere ist eine sanfte Ausblende. Gehen Sie in die Archive und gucken Sie die hoch gelobten Sendungen von damals an und Sie werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe mal alle Folgen der Familie Hesselbach gesehen, weil ich das zusammenschneiden musste... Im Übrigen haben die Leute erst rumgenörgelt, dass es diese großartigen Interviews von Günter Gauss zur Person nicht mehr gibt. Seit er sie wieder macht heißt es: Früher war der besser.
BR: Wie ist der Zusammenhang zwischen Politik und Fernsehen? Macht Fernsehen archaische Zustände möglich, stellt es sie gewissermaßen sogar her, oder zeigt es sie nur auf?
Küppersbusch: Ich glaube, da geben sich zwei nicht füreinander konstruierte, aber in segensreicher Eintracht nebeneinander existierende Aspekte die Hand. Das Fernsehen braucht, um bestmöglich zu funktionieren, Bilder, lesbare Bilder, verständliche Bilder, nach Möglichkeit auch bewegte Bilder. Der Mensch möchte von bestimmten komplizierten Sachverhalten einfache Bilder haben. Das Bild der CDU-Krise letztes Jahr wurde steil von unten, hinter zwei Zäunen durch, auf das Adenauerhaus im Tiergarten geschossen. Friedrich Merz, die Jacke abgestreift und die Ärmel hochgekrempelt, stand mit dem Rücken zur Kamera; sozusagen ein politisches Paparazzi-Bild, das signalisierte: Jetzt ist in der Familie oder im CDU-Container oder im Adelshaus ein neuer, junger Prinz, der Tatkraft demonstriert, der das Recht hat, vor dem Fürstenthron die korrekte Kleidung zu vernachlässigen. Damit war ein Bild gefunden.
BR: Beim Internet gibt es dieses eine Bild nicht.
Sandbothe: Das Internet gibt es auch nicht, sondern es gibt verschiedene Formen, dieses Medium zu nutzen. Das Netz macht das vielleicht noch deutlicher als andere Medien, weil es einfach die meisten anderen Medien - zumindest technisch - schluckt und sie neu konfigurierbar macht. Der Umgang mit Bildern beziehungsweise deren Manipulierbarkeit ist unter digitalen Bedingungen ein anderer als der Umgang mit Bildern in der klassischen Fernsehkultur, wo die Erfahrung der aktiven Manipulation nur auf der Seite der Macher ist.
BR: Ist es eine andere Form von Aufmerksamkeit, die da ausgebildet wird?
Sandbothe: Das Surfen ist die potenzierte Form des Zappens. Es ist charakteristisch, wie das System der klassischen Massenmedien das Internet auf den Begriff bringt. Ich halte Surfen für eine vollkommen unangemessene Form der Bewegung im Netz. Intelligente Bewegung im Netz heißt zunächst einmal gezieltes Recherchieren mit Suchmaschinen, Arbeit mit Intelligent Agents unter Rückbezug auf eigene Interessenlagen oder Interessenlagen lokaler Gemeinschaften, die mit Hilfe des Netzes ihren Alltag intelligenter gestalten. Die alte Logik - die Stars sitzen vorne, die Kompetenz ist auf dem Podium und das Publikum sitzt auf den billigen Rängen - funktioniert nicht mehr. Die interessanten Fragen kommen aus dem Publikum, aus Handlungszusammenhängen heraus. Das Publikum ist intelligenter geworden, es ist häufig intelligenter als das, was in den Medien präsentiert wird.
BR: Sie haben das Internet einen besseren CB-Funk genannt, Herr Küppersbusch, und gesagt: „Wer nichts wird, wird virtuell."
Küppersbusch: Ich meine damit, dass die Euphorie und die Heilssehnsucht, die mit jedem massenmedialen Technologieschub einhergegangen ist, sich immer schnell wieder legt. Zu sagen: Im Internet geht die Sonne auf, da werden keine kommerziellen Interessen verfolgt, da werden keine Zensurinteressen greifen, sondern da wird praktisch vom Medium aus eine Heilung auf den Menschen ausgeübt - dagegen verweigere ich mich weiterhin. Allerdings kann das Internet Verläufe darstellen. Ich muss im Internet nicht die Stellungnahme der Bundesregierung nur zur Kenntnis nehmen, sondern ich kann einen langen Weg von Auseinandersetzungen nachgehen. Und natürlich wächst sofort an uns als Fernsehproduzenten der Anspruch, Politik nicht mehr ergebnisartig zu referieren, sondern in Zusammenhängen darzustellen.
Sandbothe: Wir stehen jetzt wieder vor einer historischen Entscheidung in Bezug auf das Netz und seine Kommerzialisierung. Die erste Kommerzialisierungswelle hat nicht so funktioniert, wie man sich das dachte. Das war eine Form der rigiden Ökonomisierung des Netzes. Information wurde zu hohen Preisen an Eliten verkauft über Archive, an die Otto Normalverbraucher nicht herankam. Die Kommerzialisierung verlief so, dass die meisten Zeitungen ihre Archive verkauft haben. Wenn man nun in diesem Archiv eine Suchabfrage eingibt, kostet das 3,80 Mark; Suchantworten, wenn Sie einen Treffer klicken, kosten sieben Mark. Damit wurde eine enorme medienpolitische Chance verpasst, und zugleich hat man kommerziell kurzfristig gedacht. Man verkauft jetzt Informationen, die man an viele für wenig Geld, in der Summe aber mit einem enormen Verdienst verkaufen könnte, an einzelne für viel Geld. Man verdient also weniger damit, als man verdienen könnte, wenn man demokratische Formen der Kommerzialisierung dieser Archive gewählt hätte. Jetzt steht uns Micropayment bevor - der Versuch, Klickbewegungen im Netz so zu kommerzialisieren, dass dann zu bestimmende Entgelte automatisch die Konten wechseln. Die Bestimmung der Höhe dieser Entgelte mit Blick auf jeweils konkret zu diskutierende Informationssätze hat eine hohe politische Relevanz, da auf diesem Weg indirekt darüber entschieden wird, welche Intelligenz Bürgerinnen und Bürger, Zuschauerinnen und Zuschauer in Zukunft entwickeln können.
Küppersbusch: Ja, wobei du viel von dem, was mich gehemmt hat, damals in die Euphorie gegenüber dem aufstrebenden Medium einzustimmen, jetzt schon als gesellschaftliche Realität geschildert hast.
Sandbothe: Richtig.
Küppersbusch: Da bin ich vielleicht fatalistischer.
Sandbothe: Weil du eine Reihe negativer Erfahrungen gemacht hast. Trotz alledem ist es die Aufgabe der pragmatischen Philosophie, konkrete Utopien zu entwerfen.
Küppersbusch: Bei mir ist das einfach immer auch eine Frage des Erhalts meines Arbeitsplatzes gewesen. Da bin ich dann der Kulturpessimist. Wir haben noch jedes Medium niedergerockt.
Herr Küppersbusch, Herr Sandbothe, wir danken Ihnen für das Gespräch. Das Interview führten Klaus Erlach, Udo Grün und Siegfried Reusch.